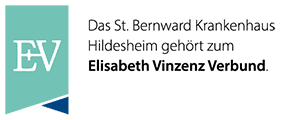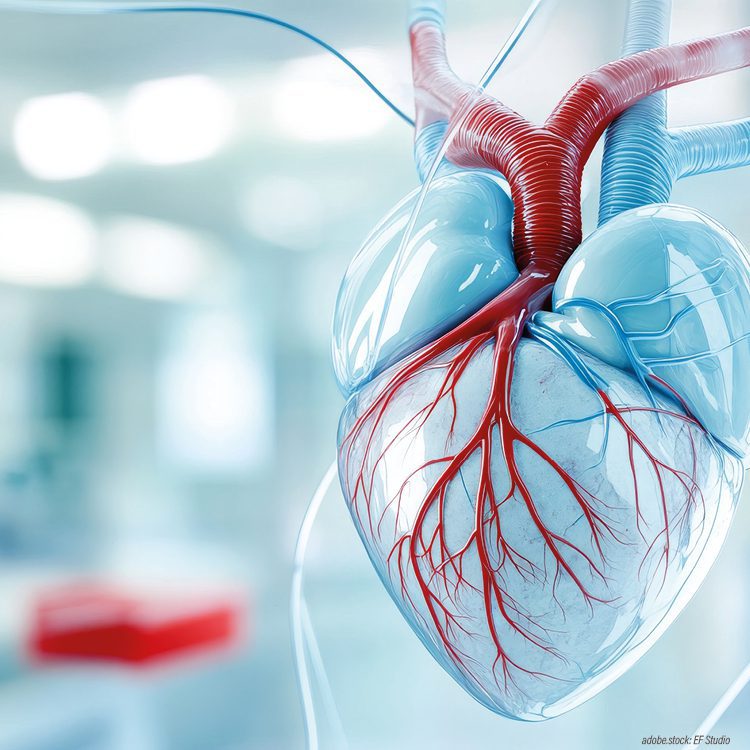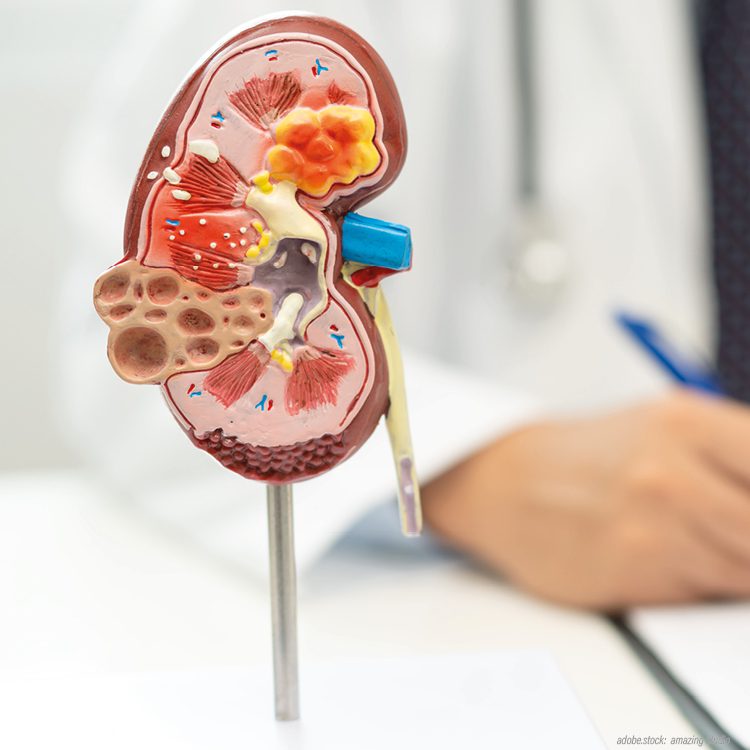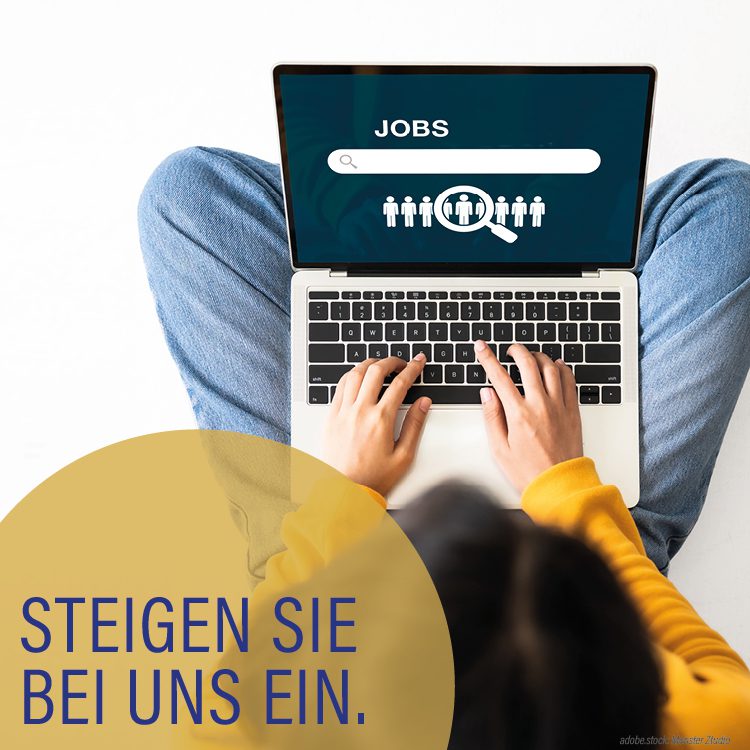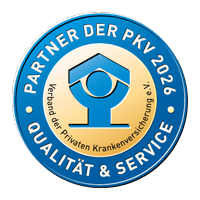Blut & Blutkreislauf – Krankheitsbilder schnell gefunden.
Die menschliche Anatomie ist komplex und vielfältig, wobei jedes Organ seine eigene Funktion erfüllt und auf eine spezielle Weise mit anderen Systemen interagiert. Dieses Zusammenspiel kann beeinträchtigt sein. Diese Beeinträchtigungen manifestieren sich manchmal in Form von Erkrankungen.
Die häufigsten Krankheitsbilder von Blut & Blutkreislauf:
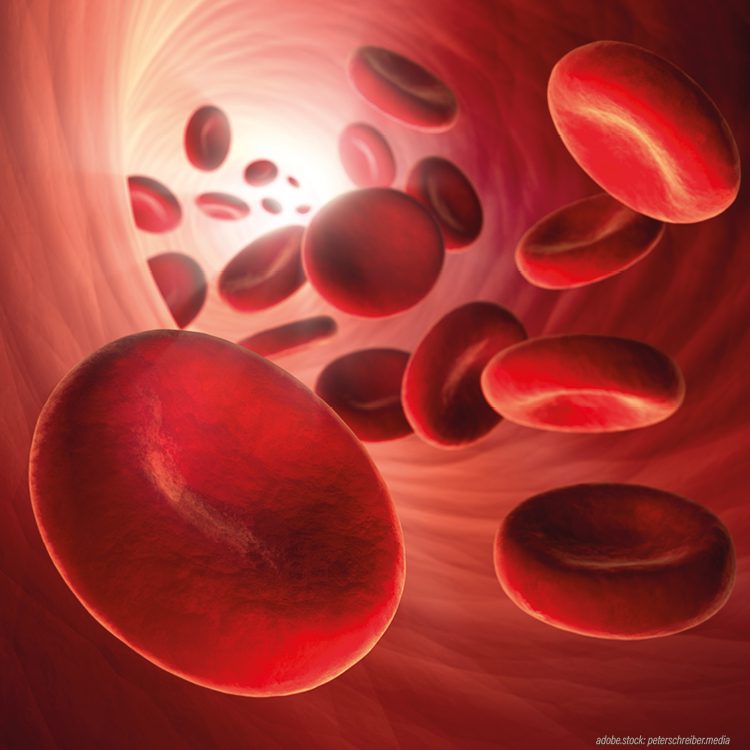
Erkrankungen der Hauptschlagader = Aorta betreffen die Aortenwand.
Ein Aorten-Aneurysma ist eine krankhafte Erweiterung der Schlagader, bzw. eine Aussackung der Hauptschlagader. Diese Aussackung vergrößert sich mit der Zeit, wodurch sich die Wandspannung erhöht und das Aneurisma einreißen kann. Neben einer genetischen Veranlagung sind Bluthochdruck, Rauchen und Arteriosklerose die Hauptrisikofaktoren für ein Aneurysma.
An der Aortenwurzel – am Übergang vom Herz zur Aorta – kann sich ebenfalls eine Aussackung = Aneurysma bilden. Manchmal sind auch die Aortenklappe und die Herzkranzgefäße mit betroffen, sodass ein herzchirurgischer Eingriff notwendig werden kann. Eingriffe in dieser Region führen wir nicht selbst durch, vermitteln aber kurzfristig an unsere Partner in umliegenden herzchirurgischen Kliniken.
Als Aortendissektion bezeichnet man einen akuten Riss in der Gefäßwand. Diese Situation ist ein Notfall, der unmittelbar abgeklärt werden muss. Ursachen können angeborene Fehlbildungen der Hauptschlagader, Erkrankungen des Bindegewebes, Alterungsprozesse, Blutergüsse oder Blutdruckspitzen sein. Therapeutisch stehen verschiedene Verfahren zur Auswahl, die von rein konservativen, über katheterbasierte, interventionelle bis hin zu offen chirurgischen Eingriffen reichen.
Eine Aortitis ist eine Entzündung der Aorta als Folge einer bakteriellen oder viralen Infektion. Sie kann eine Erweiterung der Hauptschlagader = Aneurysma zur Folge haben oder auch zu einem Riss der Aortenwand führen = Aortendissektion.
Unter Arteriosklerose = Gefäßwandverkalkung versteht man degenerative Veränderungen der Gefäßwände, insbesondere der Arterien. Zumeist führt eine Arteriosklerose zu einer Verengung des Gefäßlumens und damit zu einer Ischämie = Minderversorgung im Versorgungsgebiet der betroffenen Arterie.
Die Aortenisthmusstenose ist eine Verengung der Aorta, die zu einem arteriellen Hochdruck in den oberen Extremitäten und einer linksventrikulären Hypertrophie = Linksherzvergrößerung führen kann. Je nach Schweregrad kann es auch zu einer verringerten Durchblutung der Bauchorgane und der unteren Extremitäten, also der Beine, kommen.
In unserer Klinik für Gefäßchirurgie führen wir sämtliche offenchirurgische und interventionelle Eingriffe zur Therapie von Erkrankungen der Aorta durch. Einzige Ausnahme sind Eingriffe unmittelbar am Herzen und solche, die den Einsatz einer Herz-Lungenmaschine benötigen. Aber auch in solchen Fällen stehen wir mit Partnern in umliegenden herzchirurgischen Kliniken in Verbindung, sodass wir kurzfristige Therapieangebote vermitteln können.
Bei arteriellen Durchblutungsstörungen – auch periphere arterielle Verschlusskrankheit, kurz pAVK – genannt – handelt es sich um eine krankhafte Verengung der Arterien in Armen und Beinen. In mehr als 90 Prozent der Fälle sind die Gefäße im Becken und in den Beinen betroffen. Arterielle Durchblutungsstörungen sind meist Folge einer fortschreitenden Arterienverkalkung, also einer Arteriosklerose. Dieser Prozess kann schleichend oder akut zu einem Verschluss des Blutgefäßes führen.
Zu den Symptomen zählen teils heftige Schmerzen und Taubheitsgefühle, die auf den betroffenen Arm oder das betroffene Bein begrenzt sind. Die Körpertemperatur kann an der jeweiligen Körperstelle stark absinken. Die Haut erscheint blass und der Puls am betroffenen Arm oder Bein ist lediglich schwach oder nicht tastbar.
Bei der Schaufensterkrankheit führen Durchblutungsstörungen in den Beinen dazu, dass Betroffene beim Laufen starke Schmerzen bekommen und deshalb lediglich von einem Schaufenster bis zum nächsten laufen können bzw. dort stehenbleiben müssen, bis die Beschwerden nachlassen. Sie ist eine der häufigsten Folgeerkrankungen der Arterienverkalkung = Arteriosklerose.
In unserer Klinik für Gefäßchirurgie führen wir sämtliche offenchirurgische und interventionelle Eingriffe zur Therapie arterieller Durchblutungsstörungen, akuter Gefäßverschlüsse oder Aneurysmen durch.
Eine Wunde, die trotz Behandlung nach etwa vier bis zwölf Wochen nicht zu heilen beginnt, bezeichnet man als chronische Wunde. Diese Wunden entstehen häufig infolge von Durchblutungsstörungen, eines Diabetes mellitus, eines geschwächten Immunsystems oder von Erkrankungen der Venen, vor allem Krampfadern.
Ein Dekubitus = Druckgeschwür ist eine schlecht und langsam heilende Wunde infolge einer Minderdurchblutung der Haut und/oder des darunter liegenden Gewebes. Er entsteht meist infolge von Druck oder von Druck in Kombination mit Scherkräften. Ein Dekubitus zählt zu den häufigsten chronischen Wunden in der Krankenpflege.
Das diabetische Fußsyndrom – kurz DFS – ist eine häufige Komplikation des Diabetes mellitus.
Es entwickelt sich häufig als Folge einer lange bestehenden Diabetes-Erkrankung. Folgende Symptome können bei einem diabetischen Fußsyndrom auftreten: schlecht heilende Erosionen der Haut, rote Flecken, blasse Haut, bläulich verfärbte Stellen, gegebenenfalls schwarze Stellen – wenn das Gewebe bereits abgestorben ist –, Druckstellen und ein verringertes Schmerzempfinden. Mit Hilfe unseres klinikinternen zentralen Wundmanagements bieten wir Patienten mit chronischen Wunden eine kompetente, moderne und individuelle Therapie an.
Die Dialyse – häufig Blutwäsche genannt – ist ein Verfahren zur Reinigung des Bluts. Sie kommt meist bei Menschen mit schweren Nierenschäden zum Einsatz. Die Dialyse unterstützt oder ersetzt die Funktion der geschädigten Nieren, wenn diese den Körper nicht mehr von schädlichen Substanzen und überflüssigem Wasser befreien können. Mit Hilfe des Dialyseverfahrens werden Abfallstoffe aus dem Blut herausgefiltert und Nährstoffe hinzugefügt. Eine Dialyse-Sitzung dauert etwa vier bis fünf Stunden und wird in der Regel dreimal pro Woche durchgeführt.
Die beiden wichtigsten Dialyseverfahren sind die Hämodialyse und die Peritonealdialyse = Bauchfelldialyse. Beide ersetzen die verlorene Funktion der erkrankten Nieren.
Für eine Hämodialyse ist ein geeigneter Zugang zum Blutkreislauf erforderlich. Hierfür gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten: Kathetersysteme und sogenannte Gefäßfisteln = Shunts.
Shaldonkatheter oder Demerskatheter sind hierfür die beiden üblicherweise verwendeten Kathetersysteme. Ein Shaldonkatheter ist ein etwa 15-20 cm langer Kunststoffschlauch, der meist in eine Halsvene eingelegt wird und Blut aus einer herznahen Vene für die Dialyse zur Verfügung stellt. Dieser Katheter kann maximal zwei bis drei Wochen verbleiben und muss dann – wenn erforderlich – ersetzt werden. Der Demerskatheter ist ein Silikonschlauch, der durch einen Tunnel unter der Haut im Bereich des Brustmuskels austritt. Er kann deutlich länger im Körper verbleiben. Manche Patienten können über lange Zeiträume mit einem Demerskatheter dialysiert werden.
Die beste Art eines Gefäßzuganges für die Dialyse ist die Gefäßfistel = Shunt. Im Rahmen eines kleinen, zumeist ambulant durchgeführten gefäßchirurgischen Eingriffs wird in Narkose eine Kurzschluss-Verbindung zwischen einer Arterie und einer Vene am Arm geschaffen, die ausreichend Blut für die Hämodialyse fördert. Wichtig ist: Aus der Fistel dürfen keine Routine-Blutentnahmen erfolgen, am Shuntarm darf keine Blutdruckmessung stattfinden und Tätigkeiten mit hoher Verletzungsgefahr sowie schweres Heben sollten vermieden werden.
Die Peritonealdialyse oder Bauchfelldialyse findet im Inneren der Bauchhöhle statt. Als Reinigungsfilter des Blutes fungiert hier das körpereigene Bauchfell. Das Bauchfell kleidet die gesamte Bauchhöhle aus. Zur Durchführung der Bauchfelldialyse wird ein Silikonkatheter unter Vollnarkose in die Bauchwand eingenäht, damit die Austauschflüssigkeit in die Bauchhöhle gelangen kann. Dieser Katheter kann über viele Jahre in der Bauchwand verbleiben. Dieses Dialyseverfahren wird Continuierliche Ambulante Peritonealdialyse – kurz CAPD – genannt. Sie kann – nach einer entsprechenden Schulung – selbstständig zu Hause durchgeführt werden. Über den Katheter werden mehrmals am Tag jeweils ca. zwei Liter Austauschflüssigkeit = Dialysat in die Bauchhöhle ein- und nach etwa vier Stunden wieder ausgelassen. Der Bauch ist also über 24 Stunden mit Austauschflüssigkeit gefüllt. Durch genaue Analysen können Flüssigkeiten eingesetzt werden, die in ihrer Zusammensetzung an die individuellen Bedürfnisse des Patienten angepasst sind. Das Verfahren ist völlig schmerzfrei. Es gibt auch Varianten der CAPD, bei denen durch ein Hilfsgerät die Flüssigkeiten in der Nacht automatisch gewechselt werden – sie sind jedoch nicht für alle Patienten geeignet.
Beide Dialyseverfahren haben Vor- und Nachteile, beide bedeuten einen erheblichen Einschnitt in die Lebensgewohnheiten der Betroffenen.
Weitet sich eine Baucharterie = Bauchschlagader, geschieht das meist unbemerkt und ist zunächst harmlos. Bauchaortenaneurysmen = Aussackungen der Baucharterien bleiben oft unbemerkt, da sie meist keine Beschwerden verursachen.
Im Gegensatz zu einem Bauchaortenaneurysma, bei dem es zu einer Aussackung der Hauptschlagader kommt, kann es umgekehrt auch zu einer Verengung kommen. Das Ergebnis ist eine Durchblutungsstörung, die dazu führen kann, dass z.B. Durchblutungsstörungen der Arterien des Magen-Darm-Traktes, der Nieren oder der Becken- und Beinregionen auftreten. Typische Beschwerden sind in solchen Fällen Schmerzen nach dem Essen, Bluthochdruck oder Schmerzen beim Gehen. Grund ist auch hier zumeist eine Arteriosklerose = Verkalkung der Viszeralarterien, Nierenartierenstenose.
Postprandiale Schmerzen treten häufig nach dem Verzehr bestimmter Nahrungsmittel auf. Viele Patienten können die Nahrungsmittel exakt identifizieren, die die Symptome auslösen. Häufig treten sie nach dem Verzehr scharfer oder fettreicher Nahrung auf. Die Folge ist dann häufig eine abnehmende Nierenfunktion und Bluthochdruck.
Nierenartierenstenose bedeutet die Verminderung des Blutflusses in einer der oder beiden Hauptnierenarterien oder deren Verzweigungen.
In unserer Klinik für Gefäßchirurgie führen wir sämtliche offenchirurgische und interventionelle Eingriffe zur Therapie der betroffenen Gefäße durch.
Schrittmacher sind Geräte, die mit Hilfe schwacher elektrischer Ströme verschiedene Abläufe innerhalb des Körpers beeinflussen können. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist ein Herzschrittmacher, der dazu eingesetzt wird, um das Herz im Falle von Rhythmusstörungen wieder in den richtigen Takt zu versetzen.
Eine Weiterentwicklung der Herzschrittmachertherapie ist die sogenannte physiologische Stimulation = LBBPacing. Hier wird gezielt das herzeigene Reizleitungssystem angesteuert und so eine schonendere, natürlichere Form der Schrittmacherstimulation erreicht. Besonders bei vorgeschädigtem Herzen mit eingeschränkter Pumpkraft haben sich diese neuen Techniken bewährt.
Neben dem klassischen System kommen in unserer Klinik auch sondenlose Systeme – sogenannte Micras – zum Einsatz. Diese Schrittmachersysteme benötigen keine Elektroden mehr. Stattdessen wird das medikamentenkapselgroße Gerät vollständig in der Herzkammer verankert. Mögliche Probleme, die bei einem klassischen Herzschrittmacher durch die Elektroden entstehen können, sind so ausgeschlossen.
Andere Schrittmacher können auch dazu dienen, einen medikamentös nicht zu beherrschenden hohen Blutdruck zu reduzieren oder einer medikamentös nicht ausreichend therapierten Herzschwäche zu begegnen. In der Gefäßchirurgie werden Schrittmacher auch eingesetzt, um Durchblutungsstörungen zu mindern und begleitende Schmerzen zu reduzieren.
Alle Schrittmacher-Systeme bestehen aus einem Generator und einer oder mehreren Elektroden. Eingriffe zur Implantation von Schrittmachern erfolgen normalerweise in örtlicher Betäubung.
Das Einsetzen = Implantation von Herzschrittmachern erfolgt in Zusammenarbeit der Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin und der Klinik für Gefäßchirurgie in unseren Herzkatheterlaboren.
Die Schilddrüse befindet sich unterhalb des Kehlkopfes vor der Luftröhre. Sie gehört zu den hormonproduzierenden Organen und spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation vieler Körperfunktionen. Zu den hormonproduzierenden Organen gehören die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse, die Nebennieren und die Bauchspeicheldrüse = Pankreas. Erkrankungen der Schilddrüse können sich durch eine diffuse Vergrößerung, eine knotige Umstrukturierung oder durch eine Funktionsstörung des Organs zeigen. Dementsprechend vielseitig sind die Beschwerden.
Die Nebenschilddrüsen sind vier ungefähr erbsengroße Drüsen, die an der Rückseite der Schilddrüse liegen und das sogenannte Parathormon produzieren. Dieses Hormon reguliert den Calciumstoffwechsel.
Die beiden Nebennieren befinden sich oberhalb der rechten und linken Niere im hinteren Bauchraum. Die etwa zwei bis drei cm großen Nebennieren produzieren verschiedene Hormone – beispielsweise Adrenalin, Cortisol und Aldosteron.
Die Milz ist ein ca. faustgroßes lymphatisches Organ und liegt unter dem Rippenbogen im linken Oberbauch. Sie grenzt an den Magen, das Zwerchfell und an die linke Niere. Eine der Hauptaufgaben der Milz ist das Herausfiltern und der Abbau überalterter roter Blutzellen = Erythrozyten. Im Gegensatz zu den Lymphknoten ist die Milz nicht in das Lymphsystem, sondern in den Blutkreislauf eingebunden. Eine funktionierende Milz ist wichtig, aber – vor allem bei Erwachsenen – nicht zwingend lebensnotwendig. Muss sie – z.B. aufgrund eines Unfalls – operativ entfernt werden, übernehmen andere Körperorgane zumindest teilweise ihre Aufgaben. Nach einer solchen Milzentfernung = Splenektomie sind die Betroffenen allerdings häufig anfälliger für Infekte und weisen bei Infektionen mit bestimmten Bakterien ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe auf.
Erkranken die Schilddrüse oder die Nebenschilddrüse, oder bilden sich Tumore in den Nebennieren, ist eine Operation oft die Therapie der Wahl. Sie gibt den Patienten Sicherheit und kann eine dauerhafte körperliche Beeinträchtigung vermeiden. Selbstverständlich besprechen wir diesen Schritt mit unseren Patienten nach einer ausführlichen und differenzierten Diagnostik. Die Endokrine Chirurgie ist die Chirurgie der hormonproduzierenden Organe.
Die Überwachung des Stimmbandnervs während der Schilddrüsenoperation ist bei uns selbstverständlich. Ausgedehnte Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse können wir dank spezieller Verfahren und der notwendigen fachübergreifenden Überwachung auch älteren Betroffenen sicher anbieten – hier arbeiten wir in unserem Pankreaszentrum eng mit anderen Fachabteilungen, z.B. mit der Medizinischen Klinik III, der Gastroenterologie, zusammen. Dies gilt sowohl für chronische Entzündungen als auch für Tumorerkrankungen.
Unsere Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam in unserem zertifizierten Pankreaszentrum sowohl gut- als auch bösartige Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse umfassend und qualitätsgesichert.
Siehe auch: Pankreaskarzinom, endokrine Erkrankungen
Der Begriff Gerinnungsstörung = Hämostaseologie ist ein Oberbegriff für eine Gruppe von Erkrankungen, bei denen das Blut nicht im richtigen Maß gerinnt. Menschen mit Gerinnungsstörungen leiden deshalb unter schweren Nachblutungen z.B. nach Verletzungen, während der Menstruation, bei Unfällen oder bei Operationen. In dieses Fachgebiet gehören daher Blutungserkrankungen ebenso wie Thrombosen und Embolien.
Bei einer Thrombose verengt oder verschließt ein Blutgerinnsel = Thrombus ein Blutgefäß. Häufig entstehen Thrombosen in den Venen – meist in den Beinen. Die Venen transportieren das sauerstoffarme Blut aus dem Körper zurück zum Herzen. Bei einer arteriellen Thrombose verengt oder verschließt ein Blutgerinnsel eine Arterie. Die Arterien transportieren sauerstoffreiches Blut aus dem Herzen in den Körper. Arterielle Thrombosen sind häufig die Ursache für Herzinfarkte oder Schlaganfälle.
Damit Folgeschäden möglichst ausbleiben, sollten Thrombosen schnell behandelt werden. Während die Therapie bei massiven Thrombosen stationär erfolgt, können leichte Thrombosen in der Regel ambulant behandelt werden. Erstes Ziel ist es, das Blutgerinnsel aufzulösen und sein Wachstum zu unterbinden. Therapie der Wahl sind gerinnungshemmende Medikamente, die den Blutfluss wiederherstellen und auch der Vorbeugung von Embolien (s.u.) dienen. Neben der medikamentösen Therapie unterstützen Kompressionsstrümpfe, Krankengymnastik und physikalische Maßnahmen dabei, Symptome zu lindern, Schwellungen abzubauen und den Blutfluss in den Venen zu verbessern.
Der Verlauf und die Prognose einer Thrombose hängen davon ab, wo sie stattgefunden hat, wie groß der Thrombus war und wie schnell er aufgelöst oder entfernt werden konnte. Mögliche Folgen einer Thrombose sind – neben erneuten Verschlüssen – Embolien und das sogenannte postthrombotische Syndrom. Das postthrombotische Syndrom entsteht häufig als Folge einer Thrombose in den tiefergelegenen Venen. Typische Beschwerden sind Verfärbungen der Haut, juckende Hautausschläge, Schwellungen und Schmerzen bis hin zu offenen Geschwüren.
Embolien werden durch abgelöste Teile des Thrombus = Embolus verursacht. Der Embolus wird mit dem Blutstrom in andere Körperregionen transportiert und verursacht dort ähnliche Symptome wie eine Thrombose. Manchmal – aber eher selten – verschließt der Embolus die Lungengefäße und es kommt zu einer Lungenembolie. Da sich das Blut dann in der Herzregion staut, können die Überlastung des Herzens und ein lebensbedrohliches Herzversagen die Folge sein.
Als Risikofaktoren für Thrombosen gelten Thrombose-Vorerkrankungen, Bluthochdruck, Alter, Übergewicht, Rauchen, Diabetes mellitus, Bewegungsmangel, Venenkrankheiten – z.B. Krampfadern – Fettstoffwechselstörungen, die Einnahme von Östrogenen oder genetische Blutgerinnungsstörungen.
Unsere Klinik für Gefäßchirurgie, Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I führen sämtliche medikamentösen, offenchirurgischen und interventionellen Eingriffe zur Therapie venöser und thromboembolischer Erkrankungen durch. Dazu gehören u.a. Krampfadern, Varikose, Varikosis, Venenerweiterung, Thrombose, TVT, Thrombosen, Beinvenenthrombosen, Lungenembolien, chronisch venöse Insuffizienz und Venenschwäche. Alle hierfür wichtigen Laboruntersuchungen erfolgen in unserem Zentrallabor.
Bei sehr schweren Thrombose- oder Embolieverläufen kann ggf. auch eine kurzzeitige komplette Auflösung aller Blutgerinnung = Lysetherapie oder die Absaugung der Blutgerinnsel = Thrombektomie durchgeführt werden. Für komplexere Untersuchungen besteht eine enge Kooperation mit der Klinik für Hämostaseologie der Medizinischen Hochschule Hannover.
Siehe auch: Venöse Erkrankungen, Krampfadern
Häufig gesuchte Krankheitsbilder.
Lassen Sie sich häufige Erkrankungen über die Abbildungen anzeigen oder suchen Sie Krankheitsbilder über unser alphabetisches Glossar.