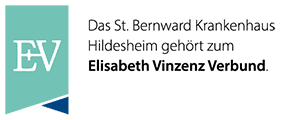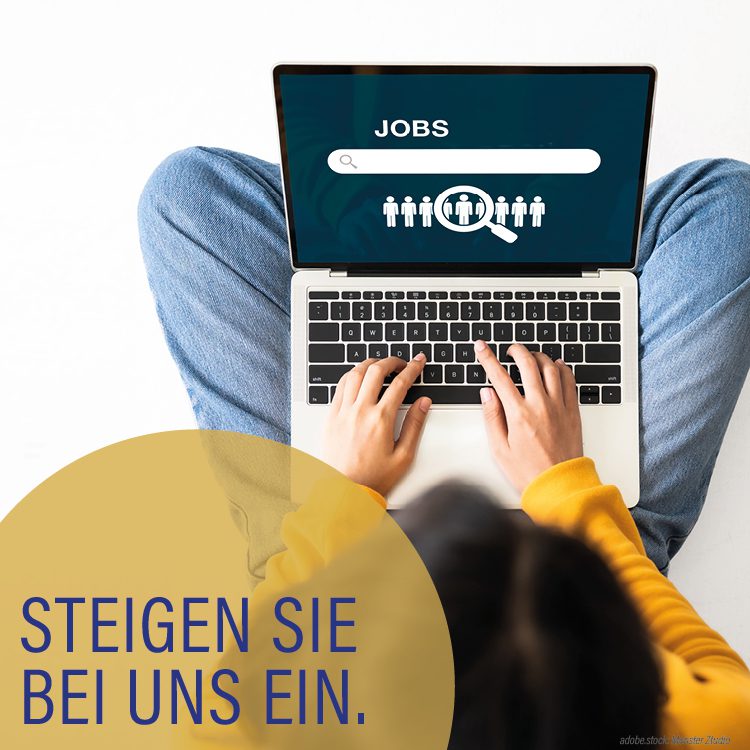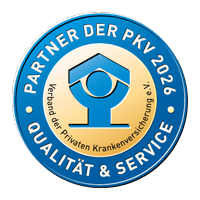Leitbild & Philosophie
“Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.”
(Mt 25,40)
Alle Häuser des Elisabeth Vinzenz Verbundes fühlen sich als konfessionelle Einrichtungen dem christlichen Menschenbild und der caritativen Arbeit verpflichtet. Diesem Anspruch entspricht das Leitbild des Verbundes und somit auch der Leitsatz des St. Bernward Krankenhauses: „Für Leib und Seele.“
Wir achten die Würde des Menschen, unabhängig von Konfession, Religion, Nationalität und gesellschaftlichem Status. Der Patient wird als Mensch in seiner Gesamtheit betrachtet und nicht als einzelner Krankheitsfall. Das menschliche Miteinander und gegenseitiger Respekt stehen im Vordergrund. Qualifizierte, zufriedene und motivierte Mitarbeiter sind dabei unsere wichtigste Ressource.
Die Leitlinien aller Einrichtungen im Elisabeth Vinzenz Verbund
Das christliche Gottes- und Menschenbild ist Grundlage und Maßstab unseres Handelns.
- Grundhaltung unseres Handelns sind Achtung und Wertschätzung gegenüber jedem Menschen. Dies gilt mit Blick auf Patientinnen und Patienten, ihre Angehörigen sowie innerhalb der Dienstgemeinschaft, unabhängig vom sozialen Status, Geschlecht, der sexuellen Orientierung, Herkunftskultur, vom religiösen Bekenntnis, von Krankheit oder Behinderung.
- Da wir den Menschen als leiblich-seelisch-geistige Einheit betrachten, gehört Seelsorge zum selbstverständlichen Angebot in unseren Einrichtungen.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Patient in allen seinen Lebensbezügen.
- Wir achten und schützen jedes Leben vom Beginn bis zum Ende, in allen seinen Phasen.
- Wir nutzen den Fortschritt der Medizin in allen Bereichen im Sinne der Patienten.
- Hierfür installieren und gebrauchen wir die Hilfestellung des Qualitäts-, Konflikts- und Risikomanagements und der klinischen Ethikkomitees.
- Wir stehen für transparente Kommunikationsstrukturen, die den Patienten in den Behandlungsprozess einbeziehen.
- Die Angehörigen und nahestehenden Personen der Patienten sind für uns wichtige Partner.
- Unsere besondere Fürsorge gilt den Schwerstkranken und den Sterbenden.
Die gegenseitige Wertschätzung ist die Basis unserer Unternehmenskultur.
- Wir pflegen einen kooperativen Führungsstil und nutzen die Kreativität und Kompetenz aller Mitarbeitenden für eine Weiterentwicklung des Verbundes.
- Unser berufliches Engagement verpflichtet uns zur Aus- und Weiterbildung.
- Bei der Lösung von Konflikten sind uns Sachlichkeit, gegenseitiges Verständnis und die Bereitschaft zur Versöhnung wichtig.
Als Teil der demokratischen Ordnung unserer Gesellschaft sind wir verlässliche und faire Partner.
- Rechtssicherheit und die Förderung der Menschenrechte sind uns natürliche Anliegen.
- Unseren Partnern im Gesundheitswesen begegnen wir fair und respektvoll.
- Wir sind regional und überregional offen für Kooperationen und andere Formen der Zusammenarbeit.
Unser wirtschaftliches Handeln orientiert sich an christlicher Sozialethik.
- Mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen gehen wir verantwortungsbewusst und wirtschaftlich um, dabei haben wir die Nachhaltigkeit der Maßnahmen im Blick.
- Die Verantwortung um die Wirtschaftlichkeit dient dem Erhalt des Verbundes.
Ein Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt dient dem institutionellen Schutz vor Vorkommnissen sexualisierter Gewalt aller Menschen. Ziel unseres Schutzkonzeptes ist, dass sich alle Menschen in unserem Haus sicher und geborgen fühlen. Wir möchten alle Mitarbeitende und Schutzbefohlene dabei unterstützen, Gefährdungen und Risiken von sexualisierter Gewalt erkennen und benennen zu können. Dafür bietet das Konzept Informationen zu Ansprechpersonen und Kontaktstellen sowie zum konkreten Verfahren, für den Fall, dass jemand von sexualisierter Gewalt betroffen ist. Um das Wissen und die Handlungskompetenz in diesem Bereich zu vertiefen und eine Kultur der Achtsamkeit zu stärken, werden alle Mitarbeitenden zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt geschult. Augen auf! Hinschauen und schützen!
Unser Schutzkonzept finden Sie im Downloadbereich unserer Website. Für Rückfragen oder Anregungen zum Thema stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Ihre Ansprechpartnerin:
Ruth Chwalczyk
Referentin für Präventionsordnung
Telefon: 05121 2821906
E-Mail: ed.shk-drawnreb@gnudlib-supmac-kb
1734 fand sich im Elsass eine Gemeinschaft von Frauen zusammen, die sich an der Spiritualität des hl. Vinzenz von Paul orientierten: den Armen und Kranken Mensch gewordene Gottesgüte zu sein. Während der Französischen Revolution breitete sich die Gemeinschaft auch im deutschen Sprachraum aus. Die Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul gründeten unter anderem ein Mutterhaus in Paderborn. Von dort aus brachen im Jahr 1852 drei Schwestern auf, um sich der Pflege der Kranken in Hildesheim anzunehmen. Der Hildesheimer Bischof Eduard Jakob Wedekin führte sie am 11. Juni nach einem feierlichen Gottesdienst im Dom in ihre neue Aufgabe in der „Krankenanstalt zum hl. Bernward“ ein.
Im Südflügel eines ehemaligen Klosters, des sogenannten Karthauses, richteten Sr. M. Theodora Franzen, Sr. M. Laurentia Tschallner und Sr. M. Eugenia Beckers die ersten Krankenzimmer ein, pflegten zudem die Menschen ambulant in den Stadtwohnungen. Die Patientenzahl steigerte sich schnell, auch aufgrund neuer weiterer Räume zur Krankenbetreuung: Wurden 1852 insgesamt 52 Kranke behandelt, waren es 1854 bereits 311. Konfessionen spielten bei der Betreuung der Patienten im St. Bernward Krankenhaus keine Rolle.
1857 erfolgte die Trennung vom Paderborner Verband und die Konstituierung eines eigenen Hildesheimer Mutterhauses, dessen erste Generaloberin Sr. M. Theodora Franzen wurde. Bischof Wedekin übereignete der Kongregation am 5. März 1868 das bis dahin beim Bischöflichen Stuhl befindliche Eigentumsrecht am St. Bernward Krankenhaus, das sich in den kommenden Jahrzehnten stetig vergrößerte und sich in der Region Hildesheim etablierte.
Während des Zweiten Weltkriegs erkannten die Nationalsozialisten Hildesheimer Vinzentinerinnen im Jahr 1939 rückwirkend bis zum Jahr 1934 die Gemeinnützigkeit ab. Eine Beschlagnahmung der Häuser konnte die Kongregation nur dadurch verhindern, dass sie diese der Reichswehr als Reservelazarette zur Verfügung stellte.
Bei den großen Luftangriffen der Aliierten auf Hildesheim im Februar und März 1945 wurde das St. Bernward Krankenhaus stark in Mitleidenschaft gezogen – die Patienten kamen vorübergehend in anderen Häusern der Vinzentinerinnen unter. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Krankenhaus rasch wieder in Betrieb genommen und weiter ausgebaut.
Bis in das Jahr 2013 blieb das St. Bernward Krankenhaus in Trägerschaft der kirchlichen Stiftung St. Bernward, die sich wiederum aus zwei Stiftern zusammensetzte: dem bischöflichen Stuhl in Hildesheim in der Person des jeweils amtierenden Bischofs und der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Hildesheim in der Person der jeweils amtierenden Generaloberin. Im Laufe des ersten Halbjahres 2013 wurde das St. Bernward Krankenhaus aus der Kirchlichen Stiftung in eine gemeinnützige GmbH überführt, die Teil des Elisabeth Vinzenz Verbundes ist – einem bundesweit tätigen Unternehmensverbund des Gesundheits- und Sozialwesens.
Die Kirchliche Stiftung St. Bernward ist – gemeinsam mit der Katholischen Wohltätigkeitsanstalt zur Heiligen Elisabeth Reinbek – Träger des Elisabeth-Vinzenz Verbundes und stellt mehrere Aufsichtsratsmitglieder.
Der Heilige Vinzenz von Paul
Vinzenz von Paul lebte von 1581-1660. Er gilt als großer Heiliger der Nächstenliebe. Er kam in einer armen Bauernfamilie in Südfrankreich zur Welt. Auf Wunsch seiner Eltern studierte er Theologie. 1600 zum Priester geweiht, strebte er jahrelang mit wechselhaftem Erfolg sozialen Aufstieg und finanzielle Sicherheit an. 1608 kam Vinzenz nach Paris, wo seine Karrierewünsche endlich in Erfüllung gingen. Dort machte er allerdings auch tiefe spirituelle Erfahrungen, die ihn für die große geistige und materielle Not vieler Menschen empfänglich machten. Fortan sah Vinzenz seine Lebensaufgabe darin, den Armen und Notleidenden zu helfen.
Er stellte allerdings bald fest, dass spontane Hilfe im Alleingang, wie es damals üblich war, wenig brachte. In Folge erwies sich Vinzenz von Paul als ein Organisationstalent und gründete 1617 eine karitative Frauen- und 1621 eine Männervereinigung zur Versorgung von Kranken und Bedürftigen, 1624 folgte eine Kongregation der Mission zur Vermittlung von Bildung und christlichem Glauben. 1633 richtete er zusammen mit der Herzogin Louise de Marillac die Genossenschaft der Töchter der christlichen Liebe, auch Vinzentinerinnen genannt, zur Pflege von Alten, Kranken und Findelkindern, und ab 1638 mehrere Waisenhäuser in Paris und Umgebung ein. Bis zu seinem Lebensende setzte sich Vinzenz unermüdlich für Arme, Kranke, Findelkinder, Sträflinge, Geisteskranke, verwahrloste Jugendliche und Vertriebene ein. 1737 wurde er heilig gesprochen.
Der Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul wurde nicht direkt von Vinzenz gegründet, sondern entstand im 18. Jahrhundert in der Nähe von Straßburg. Die Gemeinschaft betrachtet den heiligen Vinzenz als ihren geistigen Vater und führt sein soziales Engagement fort.
Der Heilige Bernward von Hildesheim
Bernward von Hildesheim, geboren um 960, entstammte dem sächsischen Adel. Nach dem Tod seines Großvaters kam er im Alter von etwa fünf Jahren an die Domschule in Hildesheim, um dort erzogen zu werden. Bereits während seiner Ausbildung zeigte sich seine Vorliebe für die schönen Künste – eine Begabung, die gefördert wurde.
Seine Priesterweihe erhielt Bernward in Mainz. 993 wurde er zum Bischof von Hildesheim ernannt – ein Amt, das er bis zu seinem Tod im Jahr 1022 inne hatte.
Während Bernwards Amtszeit zählte Hildesheim zu den Machtzentren des Reiches. Der Bischof förderte das geistliche Leben in seinem Bistum; die Versorgung von armen und kranken Menschen lag ihm am Herzen. Gleichzeitig ließ er Befestigungen und Burgen bauen sowie eine Mauer um die Stadt Hildesheim ziehen, um sein Bistum vor den Einfällen der Normannen und Slawen zu schützen. Auch für den Ausbau der Kirchenorganisation in seinem Bistum setzte sich Bischof Bernward ein. Neben dem Kloster St. Michael in Hildesheim entstanden die Nonnenklöster Heiningen bei Wolfenbüttel und Steterburg in Salzgitter sowie das Chorherrenstift Oelsburg in Ilsede bei Peine.
Sein enormes Kunstinteresse brachte Bernward dazu, die Hildesheimer Werkstätten zu gründen, die einzigartige Werke der Baukunst, Malerei, Gießerei, Goldschmiede- und Buchkunst hervorbrachten. So ließ der Bischof zu seinen Lebzeiten die Bernwardstüren des Hildesheimer Doms und die Christussäule anfertigen und veranlasste den Bau der frühromanischen Michaeliskirche (vollendet nach Bernwards Tod) – als Abbild des himmlischen Jerusalem und zugleich als seine Grabeskirche errichten. Diese bernwardinischen Kunstschätze stehen heute auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes.
Am Michaelistag, am 29. September, des Jahres 1022 weihte Bernward die noch unvollendete Abteikirche St. Michael. Am Martinstag, am 11. November, desselben Jahres wurde er Mönch dieses Benediktinerklosters, wo er am 20. November 1022 verstarb. Der Sarkophag in seiner Michaeliskirche in Hildesheim blieb allerdings leer, die Reliquien ruhen in der Magdalenenkirche.
Bernward bedeutet Althochdeutsch Schützer vor dem Bären, er wurde durch Papst Coelestin III (von 1191 bis 1198) heiliggesprochen.
Sein evangelischer und römisch-katholischer Gedenktag ist der 20. November, seine Attribute sind Bischofsornat, Kirchenmodell und insbesondere das Bernwardskreuz.
In der Walhalla in Donaustauf ist zu seiner Erinnerung schon vor 1847 eine Gedenktafel errichtet worden. Auf dem Hildesheimer Domhof steht seit 1893 das Bernwardsdenkmal. Im Bistum Hildesheim tragen viele Kirchen vor allem aus dem 18. und 20. Jahrhundert seinen Namen . Zum Beispiel die Bernwardkirche.