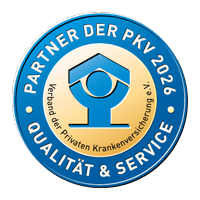Unsere Schwerpunkte – Klinik für Kardiologie, Elektrophysiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I
Die Leistungen in der Kardiologie, Elektrophysiologie und der Internistischen Intensivmedizin inklusive Chest Pain Unit umfassen die Diagnostik und Therapie sämtlicher Herzerkrankungen. Wir bieten alle gängigen konventionellen und invasiv-interventionellen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden an.
In unserer Klinik behandeln wir Patienten mit Erkrankungen der inneren Organe auch operativ – stationär und ambulant. Je nach Befund arbeiten wir eng mit unseren anderen Fachkliniken zusammen und ziehen Fachkollegen hinzu. Unser Fachgebiet teilt sich in spezielle Bereiche und Erkrankungen auf, die wir Ihnen hier näher bringen und erläutern möchten. Gleichzeitig erhalten Sie so einen Überblick über unser Leistungsspektrum.
Kernkompetenzen
Bei Bluthochdruck = Hypertonie, hypertensive Entgleisung sind die Blutdruckwerte dauerhaft zu hoch. Viele Patienten spüren erst bei sehr starken Entgleisungen des Blutdrucks Beschwerden. Die Therapie von Bluthochdruck hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind hier neben der Höhe des Blutdrucks auch vorliegende, individuelle Risikofaktoren für Folgeerkrankungen – z.B. die koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Wichtig ist es, den zu hohen Druck zu senken und abzuschätzen, ob bereits Schäden an empfindlichen Organen wie dem Gehirn, den Nieren oder am Herzen entstanden sind. Zur Abklärung erfolgen Echo-, Labor- und ggf. CT-Untersuchungen.
In der Regel wird der Blutdruck mit blutdrucksenkenden Medikamenten eingestellt. Die Bluthochdruckbehandlung ist allerdings eine längerfristige Aufgabe und wird von uns in der Klinik für Allgemeine Innere Medizin & Gastroenterologie – Medizinische Klinik III, Ihrem Hausarzt oder Hausärztin und letztlich – am wichtigsten – auch von Ihnen durchgeführt: Der Blutdruck muss regelmäßig kontrolliert und auf Veränderungen eingegangen werden.
Die Verkalkung = Sklerose der Herzkranzgefäße = Koronare Herzerkrankung – kurz KHK – ist eine der häufigsten Erkrankungen. Als chronische Erkrankung muss sie verlangsamt werden, um einem sonst drohenden Herzinfarkt entgegenzuwirken. Hierbei spielen die Analyse und Behandlung der Risikofaktoren – z.B. Rauchen, Bluthochdruck, Cholesterin – und regelmäßige kardiologische Untersuchungen mit Ultraschall = Echokardiografie eine wichtige Rolle. Die Symptome sind vielfältig, umfassen aber oft Druckgefühl oder Schmerzen in der Brust = Angina pectoris und Luftnot.
Treten neue Beschwerden auf, oder verstärken sich die bekannten, erfolgt der Ausschluss eines akuten Herzinfarktes mit Hilfe eines Elektrokardiogramms – kurz EKG – und entsprechenden Blutuntersuchungen. Hiernach können Belastungsuntersuchungen – wie z.B. Stress-Echo und Stress-MRT – Durchblutungsstörungen aufzeigen.
Die Betrachtung der Herzkrankgefäße in der Computertomographie des Herzens – kurz Kardio-CT – gibt Aufschluss über die Kalk-Last und mögliche neue Engstellen der Herzkranzgefäße. Eine Verbesserung der medikamentösen Therapie bringt oft Erleichterung. Im Zweifelsfall müssen über eine Herzkatheteruntersuchung die Gefäße angesehen und mit einem Stent = Gefäßröhrchen versorgt werden.
Unser Team in der Klinik für Kardiologie, Elektrophysiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I bietet das gesamte Spektrum der modernen Herztherapie an.
Die Aortenklappe ist die Verbindungsklappe zwischen der Schlagader = Aorta und der linken Hauptkammer. In der Austreibungsphase des Herzens = Systole öffnet sich die Klappe und das Blut wird aus der linken Hauptkammer in die Aorta gedrückt. Wenn die Klappe erkrankt, hat dies vor allem deutliche Luftnot zur Folge. Die Aortenklappe kann durch verschiedene Prozesse zu eng werden = Aortenklappenstenose oder undicht = Aortenklappeninsuffizienz. Durch spezielle Medikamente können die Defekte zu verbessert werden. Die Aortenklappenstenose ist eine häufige Erkrankung, gerade bei etwas älteren Menschen.
Zur Beurteilung der Schwere der Aortenklappenstenose wird immer die noch vorhandene restliche Öffnungsfläche der Klappe bestimmt. Ist diese Öffnung auf unter 1 cm² gefallen, muss die Klappe ersetzt werden. Hierbei bieten sich einerseits der herzchirurgische Ersatz der Klappe an (Kunstklappen oder Bioklappen) – bei manchen Patienten auch der Ersatz der Klappe über die Leiste = TAVI.
TAVI = Trans-Aortic Valve Implantation – ist häufig der Eingriff der Wahl. TAVI werden in den meisten Fällen an universitären Zentren eingesetzt. Das St. Bernward Krankenhaus arbeitet hierfür eng mit der Universitätsmedizin Göttingen zusammen.
Unser Team in der Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I bietet das gesamte Spektrum der modernen Herztherapie an. So entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept.
Siehe auch: Defekt der Mitralklappe – Mitra-Clip Defekt der Aortenklappe – TAVI
Das Herz besteht aus vier Kammern: zwei Vorkammern und zwei Hauptkammern. Die beiden Vorkammern und die beiden Hauptkammern sind jeweils durch Scheidewände getrennt. Bei Löchern oder Fehlern in der Entwicklung dieser Scheidewände kann es zu verschiedenen Erkrankungen kommen – von der Minderversorgung bis hin zum Schlaganfall.
Nach einem Ereignis – wie z.B. einem Schlaganfall – wird unter anderem auch nach solchen Defekten gesucht. Sollte sich ein solcher bestätigen, z.B. in der Vorhofscheidewand, wird in ein sogenannter Occluder (PFO, ASD oder VSD-Occluder) eingesetzt. Occluder sind Pfropfen, die Defekte im Gewebe unseres Herzens verschließen.
Bei Patienten mit Vorhofflimmern ist in den meisten Fällen eine Hemmung der Blutgerinnung durch die Einnahme von Blutverdünnern notwendig, um Schlaganfälle zu vermeiden. Manchmal kann dies zu Blutungen – z.B. im Magen oder Darm – führen. Dann kann eine Alternative sein, das Vorhofohr im linken Vorhof zu verschließen. Dort entstehen in vielen Fällen die Blutgerinnsel. Durch den Verschluss des Vorhofohres mit einem Pfropfen = LAA-Occluder müssen im Anschluss meist keine blutverdünnenden Medikamente mehr eingenommen werden.
Unser Team in der Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I bietet das gesamte Spektrum der modernen Herztherapie an.
Die Mitralklappe ist die Verbindungsklappe zwischen der linken Vorkammer und der linken Hauptkammer. In der Entspannungsphase des Herzens = Diastole öffnet sich die Klappe und Blut kann aus der Vorkammer in die Hauptkammer strömen. In der Austreibungsphase = Systole des Herzens schließt sich die Klappe und verhindert so, dass das Blut wieder in den Vorhof zurückläuft. Wenn die Klappe erkrankt, kann sie zu eng sein = Mitralklappenstenose oder undicht werden = Mitralklappeninsuffizienz. Durch verschiedene Prozesse ist die Mitralklappeninsuffizienz eine häufige kardiologische Erkrankung – vor allem des älteren Menschen. Die Erkrankung führt vor allem zu deutlicher Luftnot.
Zur Beurteilung der Schwere der Mitralklappeninsuffizienz wird immer der Grad der Undichtigkeit bestimmt. Bei hoher Undichtigkeit kann einerseits eine herzchirurgische Reparatur = Mitralklappenrekonstruktion oder ein Herzklappenersatz = Bio-Klappe oder Kunst-Klappe erwogen werden. Alternativ kann die Undichtigkeit gegebenenfalls durch einen speziellen Clip = Mitra-Clip, eine Art Büroklammer an der Herzklappe deutlich verbessert werden.
Unser Team in der Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I bietet das gesamte Spektrum der modernen Herztherapie an. So entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept.
Siehe auch: Herzklappenfehler, Defekt der Aortenklappe – TAVI
Die Entzündung des Herzmuskels = Myokarditis oder der Herzklappen = Endokarditis sind schwere Erkrankungen. Auslöser der Erkrankungen können Bakterien, Viren oder auch nicht-bakterielle Prozesse sein.
Die Myokarditis geht oft mit unspezifischen Beschwerden, Fieber und Leistungsminderung einher. In der Klinik wird die Funktion des Herzens in der Echokardiografie und –wenn nötig – der Herzmuskel im KardioMRT darstellt. Wichtig ist die längerfristige körperliche Ruhe und medikamentöse Therapie.
Bei der Endokarditis zerstören meist Bakterien die Herzklappen, so dass ein schnelles und starkes Eingreifen erforderlich ist. Oft spielt die unzureichende Zahnhygiene eine Rolle in der Entstehung. Die Entzündung muss im Ultraschall über die Speiseröhre (TEE) an der Klappe gesichert und der Erreger über Blutkulturen versucht werden zu bestimmen. Hieran schließt sich die mehrwöchige Gabe von Antibiotika über die Vene an. Sollte es nicht gelingen, die Keime ganz zu zerstören oder Komplikationen eintreten, muss die betroffene Klappe in der Herzchirurgie ersetzt werden.
Unser Team in der Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I bietet das gesamte Spektrum der modernen Herztherapie an.
Herzinfarktpatienten und Patienten mit Angina Paectoris aufgrund chronischer Verengungen der Herzkranzgefäße versorgen wir in einer 24-Stunden-Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr mit AkutBallonaufweitungen und Stentimplantationen in zwei Herzkatheterlaboren. Je nach Erfordernis werden medikamentenbeschichtete Stents der aktuellen Generation – oder nun erstmals auch resorbierbare Stents – verwendet, die sich nach Monaten im Gefäß auflösen und keine Spuren hinterlassen.
Die Herzkatheteruntersuchung = Koronarangiographie ist eine der zentralen Untersuchungen bei Verdacht auf eine Engstelle in einem Herzkranzgefäß.
Wir sind für extreme Notfälle als spezielles Reanimations-Zentrum – also als Cardiac-Arrest-Center – zertifiziert. Wir arbeiten als Heart-Team mit wöchentlichen Konferenzen eng mit dem Team der Herzchirurgie Göttingen zusammen.
Ein akuter Herzinfarkt kann verschiedene Formen und Stufen der Lebensgefahr annehmen. Bei einem sogenannten STEMI = STelevation myocardial infarction ist das komplette Herzkranzgefäß verschlossen. Zur Abwendung von Tod oder schweren Schäden muss eine sofortige Wiedereröffnung angestrebt werden. Im St. Bernward Krankenhaus besteht an 365 Tagen rund um die Stunden Bereitschaft, um Sie schnellstmöglich und optimal zu versorgen. Im Rahmen des FITT-STEMI-Netzwerkes kämpfen wir um jede Minute der Versorgung. In unserem Haus verfügen wir über sämtliche technischen Möglichkeiten und das erforderliche Know-how, auch hochkomplexe Eingriffe sicher vorzunehmen.
Eine andere Form des akuten Herzinfarktes – mit etwas besserer Prognose – ist der NSTEMI = non-STEMI. Bei diesem Infarktgeschehen ist meist nicht das gesamte Gefäß verschlossen, eine geringe Rest-Durchblutung ist noch vorhanden. Auch hier ist eine schnelle, abgestufte Versorgung nach Risikobewertung wichtig. Unsere Experten analysieren die Situation und führen sehr zügig eine Herzkatheteruntersuchung zur Versorgung des Gefäßes durch.
Durch die modernen, schonenden Therapieformen ist eine schnelle und gute Erholung oft möglich. Verschiedene Medikamente sorgen zudem für eine weitere Verbesserung des Herzens nach dem Infarkt. Im Anschluss an den Aufenthalt bei uns sind eine Rehabilitation, eine weitere kardiologische Betreuung und eine Veränderung des Lebensstils – z.B. Sport, Ernährung, Rauchstopp – wichtig.
Unser Team in der Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I bietet das gesamte Spektrum der modernen Herztherapie an. So entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept.
Von einer Herzschwäche = Herzinsuffizienz spricht man, wenn das Herz nicht ausreichend Blut auswirft, um den Bedarf des Körpers an Sauerstoff zu decken. Eine Herzinsuffizienz kann viele Ursachen haben, unter anderem eine eingeschränkte Pumpkraft des Herzmuskels, Schäden an der Ventilfunktion der Herzklappen oder mechanische Behinderungen des Blutflusses. Je nach Verlauf unterscheidet man die akute, unmittelbar lebensbedrohliche Herzinsuffizienz – bis hin zum kardiogenen Schock – und die chronische Herzinsuffizienz, bei der eine weitgehend stabile Einschränkung der körperlichen Belastbarkeit vorliegt. Auch bei einer chronischen Herzinsuffizienz sind jedoch plötzliche Verschlechterungen möglich, sogenannte kardiale Dekompensationen. Betroffene klagen häufig über Luftnot unter Belastung oder im Liegen, Wasseransammlungen = Ödeme, Schwellungen besonders an den Unterschenkeln.
Wenn eine Herzinsuffizienz festgestellt wird, steht an erster Stelle die genaue Einordnung des Mechanismus und die Suche nach behandelbaren Ursachen. So können Durchblutungsstörungen des Herzmuskels zu einer reduzierten Pumpkraft des Herzmuskels führen = Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion. Ein langjähriger Bluthochdruck führt dagegen zu verdickten, steifen Herzwänden und behindert dadurch die Füllungsphase des Herzens = Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion. Neben Durchblutungsstörungen kommen viele weitere Ursachen für eine eingeschränkte Pumpfunktion in Frage, unter anderem Herzmuskelentzündungen, Alkoholkonsum, gewisse Chemotherapien oder erbliche Veranlagungen.
Die Behandlung der Herzschwäche basiert auf drei Säulen:
- Behandelbare Ursachen sollten gefunden und bestmöglich korrigiert werden. Hierzu gehört die Untersuchung auf eine koronare Herzerkrankung = Engstellen der Herzkranzgefäße und die Behandlung von Begleiterkrankungen, die eine Herzschwäche auslösen oder verschlechtern.
- Durch eine moderne Medikamententherapie wird das Herz entlastet und der Herzmuskel zugleich gestärkt. Unter dieser Kombinationstherapie kommt es häufig zu einer deutlichen Verbesserung der Pumpfunktion und der Belastbarkeit im Alltag. Entscheidend ist die regelmäßige Einnahme der Medikamente und weiterer Maßnahmen im Alltag, wie z.B. eine konstante tägliche Trinkmenge.
- Ergänzt wird die Medikamententherapie bei einigen Patienten um implantierbaren Geräte, die vor bösartigen Herzrhythmusstörungen schützen und teilweise auch die Pumpkraft des Herzens verbessern können. Reicht auch dies nicht mehr aus, so kann eine Herztransplantation notwendig werden.
Unser Team in der Klinik für Kardiologie, Elektrophysiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I bietet in Zusammenarbeit mit der Klinik für Gefäßchirurgie einen Großteil des Spektrum der modernen Herzschwächetherapie an. Bei geriatrischen Patienten entwickelt sie gemeinsam mit der Klinik für Geriatrie & Neurogeriatrie ein maßgeschneidertes Konzept.
Die Behandlung von Herzklappenfehlern und Bypass-Operationen zählen zu den komplizierteren Eingriffen in der Herzmedizin.
Dies ist die Kompetenz des Heart-Teams. Das Team trifft sich einmal wöchentlich, um so gelagerte Krankheitsfälle zu besprechen. Teil des Teams sind Interventionalisten, Experten für Bildgebung und konservative Kardiologen des St. Bernward Krankenhauses und die Herzchirurgen der Universitätsklinik Göttingen (UMG). Das Team fest, welche Therapie die bestmögliche für den jeweiligen Patienten ist.
Unsere Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I bietet das gesamte Spektrum der modernen Herztherapie an.
Siehe auch: Defekt der Mitralklappe – Mitra-Clip, Defekt der Aortenklappe – TAVI
Innerhalb des Herzmuskels – im Sinusknoten – entstehen elektrische Impulse, die weitergeleitet werden und das Herz zum Schlagen bringen. Ist diese Elektrik des Herzens gestört, entstehen Herzrhythmusstörungen, die entweder medikamentös oder minimalinvasiv, also mittels eines kleinen Eingriffs, im Herzkatheterlabor behandelt werden können.
Der normale regelmäßige Herzrhythmus wird durch eine geordnete elektrische Erregung der Herzmuskelzellen bestimmt, die sich in fein abgestimmter Weise zusammenziehen und das Blut pumpen. Taktgeber für diesen Rhythmus ist der sogenannte Sinusknoten, der im rechten Vorhof liegt und dort, abhängig vom Bedarf des Körpers, in Ruhe meist zwischen 50 und 80 Herzschläge pro Minute auslöst. Diese Impulse breiten sich durch das sogenannte Reizleitungssystem über den Herzmuskel aus, sodass sich erst die Vorhöfe kontrahieren und nach einer kurzen Verzögerung die Kammern, die das Blut dann in die Lunge bzw. den Körperkreislauf auswerfen. Kommt es in diesem elektrischen Gefüge zu Störungen, spricht man von Herzrhythmusstörungen. Diese können entweder zu einem langsamen oder schnellen Herzschlag führen.
Langsame Herzrhythmusstörungen = Bradykardien sind häufig durch Störungen am Sinusknoten oder dem Reizleitungssystem verursacht und können in der Regel durch einen implantierbaren Herzschrittmacher behoben werden.
Bei schnellen Herzrhythmusstörungen = Tachykardien verselbstständigt sich der Herzrhythmus, d.h. es entsteht ein Herzrasen, das der Situation (körperliche oder emotionale Belastung) nicht angemessen ist. Die Mechanismen, die zu schnellen Herzrhythmusstörungen führen, sind vielfältig. Hinweise ergeben sich oft aus einem Elektrokardiogramm = EKG, das während des Herzrasens geschrieben wird. Oft ist allerdings zur genaueren Aufklärung eine sogenannte Elektrophysiologische Untersuchung mit speziellen Kathetern notwendig. In dieser Untersuchung kann oft die zugrundeliegende Ursache gezielt behandelt werden, indem der Ursprung des Herzrasens durch eine Verödung mit Hitze oder Kälte über den Katheter ausgeschaltet wird.
Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehört die Katheterablation. Mit Hilfe von Sensoren auf der Körperoberfläche und einem speziellen Katheter im Herzen wird hierbei eine hochauflösende 3D-Landkarte des Herzens und seiner elektrischen Eigenschaften erstellt – z.B. der Ursprung oder die Ausbreitungswege einer Herzrhythmusstörung. So lässt sich zielgenau und sicher krankes Gewebe veröden und die Rhythmusstörung heilen. Die Verödung = Ablation kann durch Wärme = Radiofrequenzstrom, Kälte oder hochfrequente Stromimpulse = Elektroporation erfolgen.
Die häufigste Herzrhythmusstörung ist das Vorhofflimmern, das häufig eine Alterserkrankung ist. Herzrhythmusstörungen sind im Alter eine häufige Ursache für eine akute Herzschwäche mit Wassereinlagerung – aber auch für Stürze und Bewusstseinsstörungen.
Unser Team in der Klinik für Kardiologie, Elektrophysiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I bietet das gesamte Spektrum der modernen Herztherapie an. Bei geriatrischen Patienten entwickelt sie gemeinsam mit der Klinik für Geriatrie & Neurogeriatrie ein maßgeschneidertes Konzept.
Schlaganfall = Apoplex ist der Oberbegriff für eine plötzliche akute Schädigung von Gehirngewebe, die entweder durch einen Gefäßverschluss – Hirninfarkt, ischämischer Infarkt – oder durch eine Hirnblutung – hämorrhagischer Infarkt – entsteht. Schlaganfallerkrankungen sind daher alle Erkrankungen, bei denen es durch verstopfte und geplatzte Blutgefäße im Gehirn zu einer Unterversorgung von Teilen des Gehirns kommt. Meist ist ein Gefäßverschluss die Ursache. Dabei können vorübergehende, langfristige oder dauerhafte Bewusstseinsstörungen, Lähmungen, Störungen der Sinnesfunktionen, Sprach- und Gleichgewichtsstörungen auftreten. Täglich erleiden in Deutschland etwa 550 Menschen einen Schlaganfall. Risikofaktoren sind u.a. Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus und Rauchen.
Die Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten und der zentralen Notaufnahme im St. Bernward Krankenhaus ermöglicht eine rasche Aufnahme der Patienten in unsere Klinik.
Ein Gefäßverschluss sollte schnellstmöglich beseitigt werden, da das Gehirn hochempfindlich auf Durchblutungsstörungen reagiert. Hierfür gibt es die Möglichkeiten der Lyse-Therapie, der Beseitigung des Blutgerinnsels durch eine Katheterbehandlung oder eine offene Operation. Dabei arbeitet ein interdisziplinäres Team der Klinik für Neurologie & Klinische Neurophysiologie mit weiteren Fachabteilungen des St. Bernward Krankenhauses eng zusammen.
Wenn eine Hirnblutung bzw. ein geplatztes Gefäß die Ursache des Schlaganfalls ist, normalisieren wir schnellstmöglich die Blutgerinnung – oft auch bei medikamentös bedingter Blutungsneigung. Sollte eine Hirnblutung eine Operation am Gehirn erfordern, arbeiten wir eng mit den neurochirurgischen Kliniken in der Region zusammen.
Für viele Patienten beginnt die Behandlung auf unserer speziellen Schlaganfall-Einheit, der Stroke Unit. Sie ist von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft als überregionale Stroke Unit zertifiziert. In der weiteren Diagnostik erfolgt neben der Computer- und/oder Kernspintomographie des Gehirns oft eine Ultraschalluntersuchung der hirnversorgenden Arterien und des Herzens. Ziel der Behandlung in unserer überregionalen Stroke Unit ist neben der Wiederherstellung oder Verbesserung der Blutversorgung des Gehirns auch die Identifizierung und Behandlung der Risikofaktoren. So verhindern oder reduzieren wir drohende Behinderungen.
Prophylaxe: Damit es gar nicht erst zu einem Gefäßverschluss kommt, können sich Patienten mit arteriosklerotischen Veränderungen im Bereich der Halsschlagader in der gefäßchirurgischen Ambulanz vorstellen, um das Risiko für einen Schlaganfall ermitteln zu lassen.
Patienten mit Schlaganfallerkrankungen werden von den Kliniken unseres interdisziplinären Gefäßzentrums gemeinsam betreut: Klinik für Neurologie & Klinische Neurophysiologie, der Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin, der Klinik für Gefäßchirurgie und der Klinik für diagnostische & interventionelle Radiologie, Neuroradiologie behandelt. Darüber hinaus werden sie im Rahmen unseres Gefäßzentrums im St. Bernward Krankenhaus betreut.
Vorhofflimmern ist die am häufigsten auftretende Herzrhythmusstörung. Statistisch entwickelt einer von drei Menschen im Laufe seines Lebens Vorhofflimmern. Es handelt sich um eine flimmernde elektrische Erregung in den Vorhöfen des Herzens, die unregelmäßig und häufig sehr schnell auf die Kammern übergeleitet wird. Die Folge ist ein unregelmäßiger, schneller Puls und in vielen Fällen eine innere Unruhe, abnehmende Belastbarkeit oder Luftnot. Vorhofflimmern kann jedoch auch völlig ohne Beschwerden bestehen und nur zufällig in einem EKG festgestellt werden.
Wichtig ist es, neben dem Vorhofflimmern auch Folge- und Begleiterkrankungen zu berücksichtigen. So erhöht Vorhofflimmern die Gefahr für eine Bildung von Blutgerinnseln im linken Vorhof, die zu Schlaganfällen führen können. Eine Blutgerinnungshemmung = Blutverdünnung senkt dieses Risiko, weshalb die meisten Menschen mit Vorhofflimmern dauerhaft Medikamente zur Gerinnungshemmung einnehmen sollen. Auch eine Herzschwäche kann die Folge unbehandelten Vorhofflimmerns sein – so, wie auch eine zuerst bestehende Herzschwäche umgekehrt zu Vorhofflimmern führen kann.
Zur Behandlung des Vorhofflimmerns stehen neben der gezielten Behandlung von Risikofaktoren – z.B. Gewichtsabnahme bei Übergewicht, Behandlung einer Schlafapnoe, Reduktion von Alkoholkonsum, gute Blutdruckeinstellung – Medikamente oder ein Kathetereingriff – die Lungenvenenisolation,– zur Verfügung. Durch Herzrhythmusmedikamente kann in gewissen Fällen der normale Herzrhythmus = Sinusrhythmus stabilisiert und das Auftreten von Vorhofflimmern unterdrückt werden. Bei manchen Patienten ist eine Lungenvenenisolation wirksamer als die medikamentöse Behandlung. Bei der Lungenvenenisolation werden in über einen Zugang in der Leiste Katheter in den linken Vorhof eingebracht – die Stellen, von denen das Vorhofflimmern ausgeht, gezielt mit Hitze oder Kälte verödet. In vielen Fällen kann hierdurch die Auftretenshäufigkeit des Vorhofflimmerns deutlich gesenkt oder völlig unterdrückt werden. Der Eingriff ist mit einem kurzen stationären Krankenhausaufenthalt verbunden.
Auslöser des Vorhofflimmerns sind elektrische Störsignale im Herzrhythmus = Ektopien, die ihren Ursprung in den Lungenvenen haben. Aus den Lungenvenenmündungen gelangt die elektrische Erregung in den linken Vorhof. Wenn der Vorhof hierfür empfänglich ist – z.B. aufgrund altersbedingter Veränderungen der Herzmuskelzellen, wird ein Vorhofflimmern ausgelöst. Die Katheterbehandlung von Vorhofflimmern = Pulmonalvenenisolation zielt darauf, die elektrische Verbindung zwischen den Lungenvenen und dem linken Vorhof zu unterbrechen, sodass die Störimpulse dort kein Vorhofflimmern mehr verursachen können. Bei der Pulmonalvenenisolation ist eine genaue Analyse und eine individuell angepasste Behandlungsmethode zum Erzielen der bestmöglichen Behandlungsergebnisse erforderlich.
Unser Team in der Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I bietet das gesamte Spektrum der modernen Herztherapie an. So entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept.
Interventionelle Kardiologie & Herzkatheterlabor
Zu unserem Leistungsspektrum gehören unter anderem alle Methoden der invasiven kardialen Funktionsdiagnostik. Unsere insgesamt vier Herzkatheterlabore sind mit komplexen Röntgenanlagen ausgestattet und unterliegen – wie Operationssäle – besonderen Hygiene- und Sterilitätsanforderungen. Hier erhalten Sie einen Überblick über mögliche Eingriffe und Untersuchungen:
In zwei Herzkatheterlaboren betreuen wir unsere Patienten mit speziell geschultem Personal. Herzinfarktpatienten und Patienten mit Angina Paectoris aufgrund chronischer Verengungen der Herzkranzgefäße versorgen wir in einer 24-Stunden-Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr mit Akut-Ballonaufweitungen und Stentimplantationen. Je nach Erfordernis werden Metallstents oder mit Medikamenten beschichtete Stents verwendet.
Die Herzkatheteruntersuchung (Koronarangiographie) ist eine der zentralen Untersuchungen bei Verdacht auf eine Engstelle in einem Herzkranzgefäß. Nach örtlicher Betäubung wird eine dünne Schleuse eingelegt, über die ein sehr kleiner Gefäßschlauch zum Herz geführt wird. Mittels Kontrastmittel und Röntgenstrahlen werden die Herzkranzgefäße sichtbar. Bei deutlichen Engstellen kann sofort mit einer Aufdehnung (PTCA) und / oder Stentimplantation behandelt werden. Die Punktionsstelle wird über kurze Zeit mit einem Druckverbandes versorgt. Beim Zugang über die Hand kann sich der Patient sofort aufsetzen.
Zu Herzoperationen (Bypassoperationen, Herzklappenoperationen u.a.) vermitteln wir die Patienten an herzchirurgische Kliniken weiter, vorzugsweise in die Universitätsklinik Göttingen und in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH).
Wir sind für extreme Notfälle als spezielles Reanimations-Zentrum – also als Cardiac-Arrest-Center – zertifiziert. Wir arbeiten als Heart-Team mit wöchentlichen Konferenzen eng mit dem Team der Herzchirurgie Göttingen zusammen. Ebenso mit dem Herzinfarktnetz Hildesheim-Leinebergland.
Optische Kohärenztomographie (OCT)
Die optische Kohärenztomographie (OCT) ist eine Methode zur optischen Darstellung von Herzkranzgefäßen. Hierbei wird das „Innere“ der Herzkranzgefäße, und auch das Gefäß selbst bis in etwa zwei Millimeter Tiefe analysiert. Dies ermöglicht eine sehr detaillierte Beurteilung der erkrankten Stelle der Arterie vor und nach einer Behandlung. Für die OCT wird während einer Herzkatheteruntersuchung ein Draht in das erkrankte Gefäß geführt. Über den Draht wird ein dünnes System mit einer Infrarot-Sonde eingebracht. Die Abtastung ermöglicht auch 3D-Aufnahmen der Gefäßwand.
Fractional Flow Reserve-Messung (FFR)
Gesunde Arterien können ihre Weite und damit die Durchflusseigenschaften verändern. Erkrankte Arterien können dies nur noch wenig oder gar nicht mehr. Die Fractional Flow Reserve (FFR)-Messung nutzt diesen Unterschied. Sie ermöglicht die Unmterscheidung zwischen gesunden und kranken Abschnitten im arteriellen Gefäßsystem des Herzens. Bei der Messung werden im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung Drucke an zwei Stellen gemessen. Über die entstehenden Druckunterschiede wird ein Quotient errechnet, der etwas über den Grad der Erkrankung des Gefäßes aussagt. Die Methode ist mittlerweile wissenschaftlich etablierter Goldstandard zur Beurteilung der Engstelle.
Rotablation
Bei der Rotablation werden mittels eines sehr kleinen Diamantbohrers besonders harte Verkalkungen innerhalb der Gefäße aufgebohrt. Der Bohrer schont das gesunde Gewebe, während er die Verkalkung mit >150.000 Umdrehungen pro Minute gut durchdringen kann. Hierdurch können auch sonst nicht zugängliche Engstellen versorgt werden.
Shockwave
Die Shockwave-Therapie ist eine relativ neue Therapiemöglichkeit von Engstellen an den Herzkranzgefäßen – sie ähnelt der Behandlung von Nierensteine mit Ultraschallwellen. Über einen Draht wird ein Ballon an die zu behandelnde Stelle gebracht, der spezielle Ultraschallwellen auf den harten Kalk abgibt. Hierdurch kann – unter Schonung des gesunden Gewebes – der Kalk aufgebrochen und so die Stelle einer weiteren Versorgung zugänglich gemacht werden.
Coronare Mikrovaskuläre Dysfunktion – CMD-Messung
Die koronare mikrovaskuläre Dysfunktion ist die Erkrankung der kleinsten Endstücke der Herzkranzgefäße. Diese können weder während einer Herzkatheteruntersuchung, noch im Kardio-CT oder MRT dargestellt werden. Dennoch ist eine Verengung dieser kleinsten Gefäße die Ursache vieler Beschwerden. Unsere Klinik kann als eine der ersten in Deutschland die CMD mittels neuester Technologien messen. Da es aktuell noch nicht die „eine“ Tablette zur Behandlung der CMD gibt, ist die Therapie meist eine Kombination von mehreren Maßnahmen.
Impella-System
Das Impella-System ist eine Unterstützungs-Pumpe für die linke (und ggf. rechte) Herzseite. In einem Zeitraum von bis zu 72 Stunden kann so das Herz entlastet werden. Anwendungsgebiete sind einerseits Eingriffe mit einem etwas höheren Risiko, in denen das Herz zeitweise Unterstützung benötigen könnte. Andererseits kann sich der Bedarf für eine Unterstützung im Rahmen eines STEMI / Herzinfarktes entwickeln, damit sich das Herz sich besser erholen kann.
Antegrade & retrograde CTO-Prozedur
Ein chronisch verschlossenes Herzkranzgefäß (chronic total occlusion – CTO) stellt immer eine besondere Herausforderung an einen interventionellen Kardiologen. Nur wenige Zentren in Deutschland sind in der Lage, die betroffenen Gefäße von vorn (antegrad) oder – über andere Gefäße – rückwärts (retrograd) wieder zu eröffnen. Diese Möglichkeit können wir Ihnen in der Kardiologischen Klinik im St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim anbieten. Voraussetzung für eine CTO-Prozedur ist, dass das Herzmuskel-Gewebe hinter dem Verschluss noch funktionsfähig ist. Zur Feststellung einer Narbe erfolgt daher in der Regel ein Kardio-MRT vor dem Eingriff.
Das Hildesheimer Herzinfarktnetzwerk ist eine Kooperation des St. Bernward Krankenhauses mit den Kliniken in Alfeld und Gronau sowie den Rettungsdiensten in Hildesheim. Das Netzwerk dient der optimalen Versorgung von Patienten mit ST-Hebungsinfarkt und stellt eine flächendeckende Versorgung von Patienten mit Herzinfarkten sicher.
Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute! Das verschlossene Gefäß muss so schnell wie möglich wiedereröffnet werden. Um dies sicherzustellen, arbeiten wir im Herzinfarktnetz Hildesheim-Leinebergland und als Mitbegründer des FITT-STEMI-Netzwerkes eng mit anderen Kliniken und Rettungsdiensten zusammen. Das Ziel des FITT-STEMI-Projekts, mit mehr als 50 teilnehmenden Krankenhäusern – u.a. die MHH und die Uniklinik Göttingen –, ist die konsequente Verbesserung der Versorgung von Herzinfarktpatienten, um die Prognose und das Überleben der Betroffenen zu steigern.
Dank innovativer Qualitätsmanagement-Maßnahmen konnten unter systematischer Einbeziehung der Rettungssysteme die „Contact-to-balloon“- und die „Door-to-balloon“-Zeiten erheblich verbessert werden. Hierzu zählen die 24-Stunden-Bereitschaft des Herzkatheterteams und die schnelle Diagnosesicherung bereits im Notarztwagen mittels moderner Telemedizin. Jede Minute zählt!
Das Modell aus Hildesheim gewährleistet eine vorbildliche Infarktbehandlung – auch im internationalen Vergleich – und erfährt daher breite nationale und internationale Beachtung.
Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehört die Katheterablation. Mit Hilfe von Sensoren auf der Körperoberfläche und einem speziellen Katheter im Herzen wird hierbei eine hochauflösende 3D-Landkarte des Herzens und seiner elektrischen Eigenschaften erstellt (z.B. der Ursprung oder die Ausbreitungswege einer Herzrhythmusstörung). So lässt sich zielgenau und sicher krankes Gewebe veröden und die Rhythmusstörung heilen. Die Verödung (Ablation) kann durch Wärme (Radiofrequenzstrom), Kälte oder hochfrequente Stromimpulse (Elektroporation) erfolgen.
Die häufigste Herzrhythmusstörung ist das Vorhofflimmern. Durch eine chaotische Herzerregung in den Vorhöfen des Herzens kommt es zu unregelmäßigem und häufig sehr schnellem Herzschlag (Puls). Darüber hinaus erhöht Vorhofflimmern das Risiko von Schlaganfällen durch Gerinnselbildung im Herzen und damit auch das Risiko von Gefäßverschlüssen. In diesen Situationen ist die Blutverdünnung (Antikoagulation) durch gerinnungshemmende Medikamente erforderlich. Zur Blutgerinnungshemmung werden inzwischen fast ausschließlich moderne direkte orale Antikoagulanzien (DOAK) verwendet. Sie erfordern Im Rahmen einer festen täglichen Dosis keine regelmäßigen Gerinnungskontrollen mehr.
Auslöser des Vorhofflimmerns sind elektrische Störsignale im Herzrhythmus, sogenannte Ektopien, die ihren Ursprung in den Lungenvenen haben. Aus den Lungenvenenmündungen gelangt die elektrische Erregung in den linken Vorhof. Wenn der Vorhof hierfür empfänglich ist, beispielsweise aufgrund altersbedingter Veränderungen der Herzmuskelzellen, wird Vorhofflimmern ausgelöst. Die Katheterbehandlung von Vorhofflimmern (Pulmonalvenenisolation) zielt darauf, die elektrische Verbindung zwischen den Lungenvenen und dem linken Vorhof zu unterbrechen, sodass die Störimpulse dort kein Vorhofflimmern mehr verursachen können. Bei der Pulmonalvenenisolation legen wir Wert auf eine genaue Analyse und eine individuell angepasste Behandlungsmethode zum Erzielen der bestmöglichen Behandlungsergebnisse.
Das Einsetzen (Implantation) von Herzschrittmachern erfolgt in Zusammenarbeit mit unserer Klinik für Gefäßchirurgie in unseren Herzkatheterlaboren.
Herzschrittmacher verhindern einen zu langsamen Herzschlag. Das Herzschrittmacher-System besteht aus einem Generator und einer oder mehreren Elektroden. Es wird in der Regel in örtlicher Betäubung über einen kleinen Hautschnitt unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt. Die Elektroden werden von dort über die Blutgefäße zum Herzen geführt.Der Schrittmacher zeigt dem Herzen mit Hilfe elektrischer Impulse an, wann es schlagen soll. Dabei kann der Schrittmacher seine Frequenz – und damit die des Herzens – der jeweiligen körperlichen Belastung anpassen. Wenn das Herz selbständig genügend eigene Schläge erzeugt, nimmt dies der Schrittmacher wahr und hält sich zurück. Bei zu starkem Absinken der Herzfrequenz setzt er mit der vorgegebenen Frequenz sofort wieder ein.
In einigen Fällen kommen zur Erfassung von Herzrhythmusstörungen sogenannte Event-Rekorder (Ereignis-Rekorder) zum Einsatz. Dies sind kleine Geräte, die kurzfristig auftretende Rhythmusstörungen des Herzens dokumentieren. Der Patient kann sie selbst bedienen. Bei Ohnmachtszuständen unklarer Ursache können die Geräte problemlos unter die Haut eingesetzt werden. Sie erfassen selbsttätig Rhythmusstörungen. Erst mit Hilfe dieser Geräte kann manchmal geklärt werden, ob ein Herzschrittmacher erforderlich ist.
Eine Weiterentwicklung der Herzschrittmachertherapie ist die sogenannte physiologische Stimulation (LBB-Pacing). Hier wird gezielt das herzeigene Reizleitungssystem angesteuert und so eine schonendere, natürlichere Form der Schrittmacherstimulation erreicht. Besonders bei vorgeschädigtem Herzen mit eingeschränkter Pumpkraft haben sich diese neuen Techniken bewährt.
Neben dem klassischen System kommen in unserer Klinik auch sondenlose Systeme (Micra) zum Einsatz. Diese Schrittmachersysteme benötigen keine Elektroden mehr. Stattdessen wird das medikamentenkapselgroße Gerät vollständig in der Herzkammer verankert. Mögliche Probleme, die bei einem klassischen Herzschrittmacher durch die Elektroden entstehen können, sind so ausgeschlossen.
Defibrillatoren werden wie ein Herzschrittmacher eingesetzt. Sie erkennen gefährliche Herzrhythmusstörungen – z.B. Kammerflimmern, ventrikuläre Tachykardie – und gibt im Notfall selbstständig eine rettende Überstimulation oder einen Stromstoß ab. Klassische – sogenannte transvenöse – ICDs nehmen den Herzrhythmus über Elektroden wahr, die durch die Blutgefäße zum Herzen führen. Für manche Patienten kommt diese Lösung allerdings nicht Frage, weil z.B. Gefäße verschlossen sind oder ein hohes Risiko besteht, dass sich Elektroden im Blutstrom infizieren. Hier stehen Systeme zur Verfügung, die vollständig außerhalb des Gefäßsystems liegen – entweder mit einer Elektrode unter der Haut (subkutaner ICD) oder im Brustkorb, aber außerhalb des Herzens (EV-ICD).
Bei Patienten mit ausgeprägter Herzschwäche (Herzinsuffizienz) trotz optimaler medikamentöser Behandlung und gleichzeitiger Erregungsleitungsstörung im EKG (sogenannter Linksschenkelblock mit QRS-Komplex: >120-150 ms) kann durch das Einsetzen eines speziellen Herzschrittmachers oft eine wesentliche Besserung der Belastbarkeit und auch eine Lebensverlängerung erreicht werden.
Ein krankhaft veränderter Bewegungsablauf der rechten und linken Herzkammer wird durch diesen besonderen Schrittmacher wieder koordiniert, weshalb auch von einer kardialen Resynchronisations-Therapie (CRT) gesprochen wird.
Meist wird ein kombiniertes Herzschrittmacher-Defibrillator-System (CRT-D) eingesetzt, um die Patienten mit einer schwer eingeschränkten Pumpfunktion der linken Herzkammer vor lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen und effektiv vor dem plötzlichen Herztod zu schützen.
Nach einem Ereignis – wie z.B. einem Schlaganfall – wird unter anderem auch nach solchen Defekten gesucht. Sollte sich ein solcher bestätigen, z.B. in der Vorhofscheidewand, wird in ein sogenannter Occluder (PFO, ASD oder VSD-Occluder) eingesetzt. Occluder sind Pfropfen, die Defekte im Gewebe unseres Herzens verschließen.
Bei Patienten mit Vorhofflimmern ist in den meisten Fällen eine Hemmung der Blutgerinnung durch die Einnahme von Blutverdünnern notwendig, um Schlaganfälle zu vermeiden. Manchmal kann dies zu Blutungen – z.B. im Magen oder Darm – führen. Dann kann eine Alternative sein, das Vorhofohr im linken Vorhof zu verschließen. Dort entstehen in vielen Fällen die Blutgerinnsel. Durch den Verschluss des Vorhofohres mit einem Pfropfen (LAA-Occluder) müssen hinterher meist keine blutverdünnenden Medikamente mehr eingenommen werden.
Dies ist die Kompetenz des Heart-Teams. Das Team trift sich einmal wöchentlich, um solche Krankheitsfälle zu besprechen. Teil des Teams sind Interventionalisten, Experten für Bildgebung und konservative Kardiologen des St. Bernward Krankenhauses und die Herzchirurgen der Universitätsklinik Göttingen (UMG). Sie legen gemeinsam fest, welche Therapie die bestmögliche für den jeweiligen Patienten ist.
Defekt der Mitralklappe – Mitra-Clip
Insbesondere bei älteren oder vorerkrankten Herzen kommt es häufig zu Undichtigkeiten der Mitralklappe. Die Mitralklappe ist die Verbindungsklappe zwischen dem linken Vorhof und der linken Hauptkammer. Ihre hochgradige Undichtigkeit führt zu schwerer Luftnot, Lungenentzündungen und Herzschwäche. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist ebenfalls deutlich eingeschränkt.
Lange Zeit war neben einer medikamentösen Therapie meist nur der Ersatz der Klappe durch die Herzchirurgie möglich. Heute kann die Klappe oft repariert oder ihre Funktion mit Hilfe eines Clips – ähnlich einer kleinen Büroklammer – verbessert werden. Dieser Clip – der sogenannte Mitra-Clip – verbindet die beiden Segel der Klappe an einer Stelle fest und verringert so die Undichtigkeit deutlich.
Defekt der Aortenklappe - TAVI
Die Aortenklappe ist die Verbindungsklappe zwischen linker Hauptkammer und der Schlagader (Aorta). Aus mehreren Gründen kann es zu einer Verkalkung und zunehmenden Verengung dieser Klappe kommen. Ist die Aortenklappe hochgradig (zu) eng, muss sie ersetzt werden. Ein solcher Eingriff kann inzwischen bei älteren Patienten etwas schonender über die Leiste erfolgen.
Dieser Eingriff wird Trans-Aortic Valve Implantation – kurz TAVI – genannt und ist häufig die Option der Wahl. TAVI werden in den meisten Fällen an universitären Zentren eingesetzt. Das St. Bernward Krankenhaus arbeiten hierfür eng mit der Universitätsmedizin Göttingen zusammen.
Nichtinvasive kardiale Funktionsuntersuchungen
In der transthorakalen Echographie (TTE) wird das Herz mit einer Ultraschall-Sonde von außen betrachtet. Bei speziellen Fragestellungen ist manchmal eine transösophageale Echographie (TEE) notwendig. Bei dieser Untersuchung wird ein Schlauch – wie bei einer Magenspiegelung – mit einem (3D-) Schallkopf in der Speiseröhre platziert. So lässt sich das Herz noch etwas besser „von innen“ betrachten. Dies ist meist bei Herzklappenfehlern oder Vorhofflimmern erforderlich.
Die Stressechokardiographie erfolgt während körperlicher oder pharmakologischer Belastung, auf der Suche nach Hinweisen für eine Durchblutungsstörung des Herzmuskels.
Im Stress-MRT kann ähnlich wie in der Stress-Echokardiographie das Herz unter Belastung untersucht werden. So werden auch geringe Durchblutungsstörungen früh gesehen.
Im St. Bernward Krankenhaus kommen mit einem 1,5- und einem 3-Tesla-MRT modernste Medizingeräte zum Einsatz. Die Untersuchungen erfolgen in Kooperation mit der Klinik für diagnostische & interventionelle Radiologie und Neuroradiologie (LINK).
Im Kardio-CT können die Kalkbelastung der Herzkranzgefäße genau analysiert und die Herzkranzgefäße selbst auf Engstellen untersucht werden. So können koronare Herzerkrankungen ausgeschlossen oder notwendige Herzkatheteruntersuchungen geplant werden. Manchmal ist das Kardio-CT auch in Vorbereitung für bestimmte Eingriffe notwendig, z.B. wenn Herzstrukturen in 3D rekonstruiert werden müssen.
Im St. Bernward Krankenhaus steht ein 64-Zeilen-CT mit großer Röhre zur Verfügung. Die Untersuchungsdauer ist kurz. Untersuchungen im Kardio-CT erfolgen in Kooperation mit der Klinik für diagnostische & interventionelle Radiologie und Neuroradiologie (LINK).
Die Spigoergometrie ermöglicht die exakte Bestimmung der der Leistungsfähigkeit von Herz und Lunge – der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit. Wichtig ist dies z.B. bei Patienten mit Herzschwäche, aber auch bei Gesunden z.B. für das Testen und Messen der Leistungsfähigkeit von Sportlern.

Chefarzt | PD Dr. med. Stephan Hohmann
Klinik für Kardiologie, Elektrophysiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I

Sekretariat | Gabriele Hoffmann
Tel.: 05121 90-1036 | Fax: 05121 90-1282
E-Mail Kontakt
Weitere Infos auch in unserer Sprechzeitenübersicht.

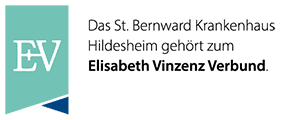
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Text das generische Maskulinum. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir alle Geschlechter ansprechen.