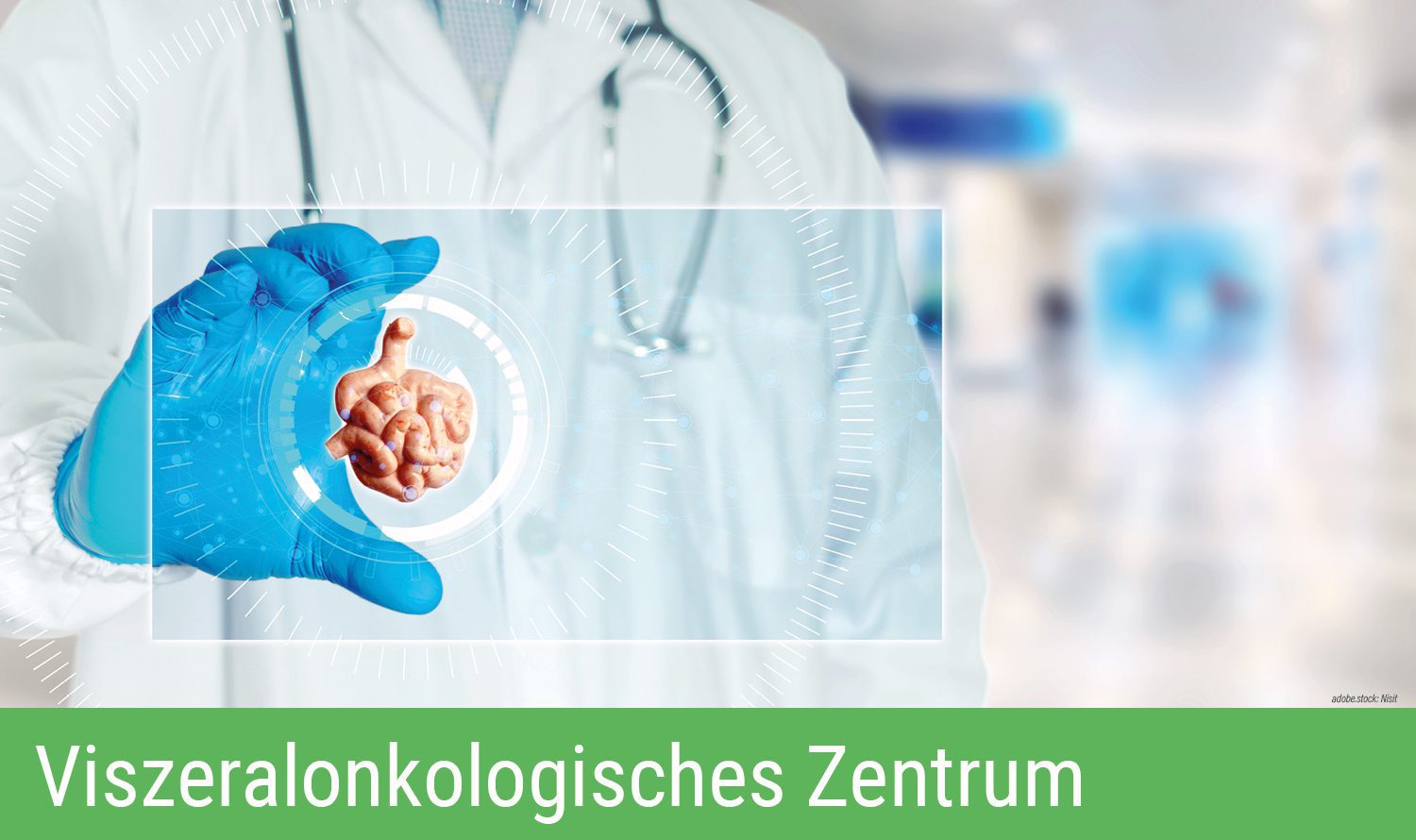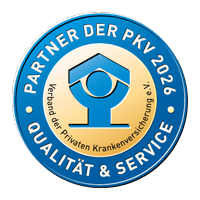Unsere Schwerpunkte
– Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & spezielle Viszeralchirurgie
In unserer Klinik behandeln wir Patienten mit Erkrankungen der inneren Organe operativ – stationär und ambulant. Je nach Befund arbeiten wir eng mit unseren anderen Fachkliniken zusammen und ziehen Kollegen hinzu. Unser Fachgebiet teilt sich in spezielle Bereiche und Erkrankungen auf, die wir Ihnen hier näher bringen und erläutern möchten. Gleichzeitig erhalten Sie so einen Überblick über unser Leistungsspektrum.
Kernkompetenzen
Als Bauchfellkrebs oder Peritonealkarzinose wird der Befall der Auskleidung der Bauchraumorgane – des Bauchfells = Peritoneums – mit bösartigen = malignen Tumorzellen bezeichnet. Die Diagnose Bauchfellkrebs steht fast immer für einen komplexen Verlauf einer Krebserkrankung. Es gibt viele auslösende Krebsarten und unterschiedliche Stadien des Befalls. Genauso komplex ist daher die Entscheidungsfindung zur passenden Therapie. In enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Spezialisten aus dem St. Bernward Krankenhaus wie Onkologen, Gynäkologen oder Urologen kann eine sinnvolle, individuelle Therapie geplant und durchgeführt werden. Informieren Sie sich hier weiter zum Thema “Bauchfellkrebs”.
Das Bauchfell = Peritoneum ist von dem griechischen Wort peritonaion = das Ausgespannte abgeleitet und besteht aus einer dünnen Haut, die den Bauchraum von innen auskleidet. Die Oberfläche des Bauchfells ist sehr groß, sie beträgt in etwa eineinhalb bis zwei Quadratmeter. Das Bauchfell umgibt sowohl die Innenseite der Bauchwand (Peritoneum parietale), als auch die Organe des Bauchraumes (Peritoneum viscerale). Das Peritoneum viscerale umschließt dabei die meisten Baucheingeweide. Dieser Teil des Bauchfells produziert die sogenannte Peritonealflüssigkeit, die wie ein Schmiermittel dafür sorgt, dass die Organe im Bauchraum nicht gegeneinander reiben, sondern sich gut bewegen können. Beim Bauchfellkrebs haben sich in dem Organ bösartige Tumorzellen gebildet, die aber nur sehr selten im Bauchfell selbst entstanden sind. In den meisten Fällen handelt es sich bei diesen Krebszellen um Tochtergeschwülste (Metastasen) von fortgeschrittenen bösartigen Tumoren, die in anderen Organen innerhalb des Bauchraums sitzen, den sogenannten Primärtumoren. Durch die vom Bauchfell produzierte Peritonealflüssigkeit, die das Gleiten der Darmschlingen unterstützt, können sich die in den Primärtumoren entstandenen Krebszellen im Bauchraum ausbreiten und schließlich das Bauchfell oder andere Organe befallen. Oft beobachtet man diese Ausbreitung bei gastrointestinalen Krebserkrankungen wie Dickdarmkrebs = kolorektales Karzinom, Dünndarmkrebs und bösartigen Geschwülsten an der Bauchspeicheldrüse = Pankreaskarzinom sowie bei Eierstockkrebs = Ovarialkarzinom.
In seltenen Fällen können auch Tumore außerhalb des Bauchraums, beispielsweise Tumore der Brustdrüse, Bauchfellkrebs verursachen. Denn jeder Tumor, der über die Begrenzungen seines Ursprungsorgans hinauswächst, kann bösartige Zellen in den Bauchraum aussenden. Diese Zellen können sich am Bauchfell festsetzen, dort weiterwachsen und schließlich Tumorknoten bilden.
Beim Bauchfellkrebs wird zwischen zwei Arten unterschieden:
Diffuse Karzinose: Von einer diffusen Karzinose wird gesprochen, wenn sich die Tumorknoten im gesamten Bauchraum oder auch auf der Oberfläche anderer Bauchorgane gebildet haben.
Lokalisierte Karzinose: Bei einer lokalisierten Karzinose haben sich einzelne Tumorknoten auf einem begrenzten Gebiet gebildet und sich noch nicht weiter ausgebreitet.
Symptome
Zu Beginn der Erkrankung klagen viele Patienten über Verstopfung = Obstipation oder Bauchschmerzen = Abdominalschmerzen, die oft mit Hausmitteln behandelt werden. Wenn sich die Tumorzellen immer weiter ausbreiten, kommt es in den meisten Fällen zu Funktionsstörungen der Organe innerhalb des Bauchraums. Dies können sein: Einschränkungen der Darmtätigkeit, Darmverschlüsse = Subileus und Ileus, Probleme beim Wasserlassen = Ischurie, Bildung von Bauchwasser = Aszites, Übelkeit, Völlegefühl, Appetitlosigkeit und Brechreiz sind oft weitere Begleiterscheinungen.
Diagnosestellung
Ob ein Patient an Bauchfellkrebs erkrankt ist, wird in den meisten Fällen mit Hilfe einer Computertomographie festgestellt. Um die Tumorzellen sichtbar zu machen, kommen bei der Computertomographie Kontrastmittel zum Einsatz. Der Ursprung, der Befall und die Ausbreitung der Tumorzellen können stark variieren. Dementsprechend fallen der Krankheitsverlauf und die Prognose für jeden Betroffenen anders aus.
Wie bereits beschrieben, wird von einer limitierten oder lokalisierten Peritonealkarzinose gesprochen, wenn sich die Tumorzellen nur in begrenzten Abschnitten des Bauchfells ausgebreitet haben. Dies betrifft vor allem Organe innerhalb des Bauchraums, die sich nur wenig aktiv selbst bewegen, zum Beispiel den Blinddarm = Zökum oder bei Frauen die tiefste Stelle der Bauchhöhle = Douglas-Raum. Bei der häufiger auftretenden, diffusen Peritonealkarzinose ist das gesamte Bauchfell mit größeren, flächenhaft verstreuten Tumorknoten befallen, zum Teil gilt dies auch für angrenzende Organe. Bis vor kurzem war die Diagnose Bauchfellkrebs gleichbedeutend mit einer kurzen Lebenserwartung, da es sich hierbei um eine sogenannte generalisierte Tumorerkrankung handelt – sprich, ein Krankheitsbild, das den ganzen Körper betrifft. Eine Heilung schien somit ausgeschlossen. Mittlerweile gibt es – dank einer neuen chirurgischen Therapieform, der sogenannten Hyperthermen intraperitonealen Chemotherapie – kurz HIPEC – sehr ermutigende Ergebnisse.
Therapien bei Bauchfellkrebs – welche ist geeignet?
Die Diagnose Bauchfellkrebs steht fast immer für einen komplexen Verlauf einer Krebserkrankung. Es gibt viele auslösende Krebsarten und unterschiedliche Stadien des Befalls. Genauso komplex ist es, die passende Therapie zu finden. Sowohl bei der medikamentösen Behandlung von Bauchfellkrebs mit Chemotherapeutika als auch bei Operations- oder Bestrahlungsmethoden ergeben sich laufend neue Entwicklungen. Die klinische und wissenschaftliche Auswertung und Hinterfragung von Behandlungen und Behandlungsergebnissen haben einen zeitnahen Einfluss auf das Vorgehen von morgen. Entscheidend ist, für den einzelnen Patienten eine individuelle Therapie zu finden, die Risiken und Erfolgschancen nach aktuellen Erkenntnissen gegeneinander abwägt.
Bei der Suche nach der geeigneten Therapieform spielen mehrere Faktoren eine Rolle:
- Untersuchungen mittels bildgebender Diagnostikmethoden (MRT, CT)
- Befunde aus vorangegangenen Operationen
- Pathologische Berichte und Laborwerte
- allgemeiner körperlicher Zustand
Tumorkonferenz: Viele Spezialisten für einen Patienten
Der Krankheitsverlauf jedes einzelnen Patienten wird in der sogenannten interdisziplinären Tumorkonferenz besprochen. Diese Runde wird von unseren zertifizierten Zentren Onkologisches Zentrum und Darmkrebszentrum einberufen. An der Tumorkonferenz nehmen Ärzte verschiedener Fachrichtungen teil, unter anderem Allgemein-, Viszeral- und onkologische Chirurgen, medizinische Onkologen, Nuklearmediziner, Gynäkologen und Pathologen. Gemeinsam prüfen sie vorliegende Befunde, schätzen anhand der oben genannten Faktoren ein, welche Therapie für den jeweiligen Patienten die individuell am besten geeignete ist und geben eine Empfehlung ab. Erst dann wird die Therapie vorbereitet und eingeleitet.
Behandlung von Bauchfellkrebs im St. Bernward Krankenhaus
Bei der Entscheidung, ob bei einem Patienten mit Bauchfellkrebs = Peritonealkarzinose eine Entfernung des Bauchfells = Peritonektomie in Kombination mit dem HIPEC-Verfahren erfolgen soll, ist eine enge Zusammenarbeit der Chirurgen mit Radiologen, Gynäkologen, Urologen, Onkologen, Intensivmedizinern, Ernährungsberatern und vielen anderen Fachleuten zwingend erforderlich. Auch bei der Betreuung des Patienten nach der Operation ist es wichtig, ein multiprofessionelles, speziell geschultes Team an seiner Seite zu wissen. Das St. Bernward Krankenhaus vereint sämtliche Experten unter einem Dach.
Auch eine Ausstattung mit moderner Medizintechnik, wie das St. Bernward Krankenhaus sie bietet, ist bei einem solch aufwendigen Operationsverfahren unerlässlich. Sämtliche Zytostatika können in unserer hauseigenen Krankenhausapotheke tagesaktuell hergestellt werden. Somit sind eine valide, gesicherte Herstellung sowie kurze Transportwege zum Patienten gewährleistet. Die Behandlung mit dem HIPEC-Verfahren geht mit zahlreichen postoperativen Besonderheiten und Schutzmaßnahmen einher. Da Zytostatika als Gefahrenstoffe gelten, die bei gesunden Menschen als krebserregend eingestuft werden, wird unser medizinisches und pflegerisches Personal regelmäßig im Umgang mit diesen Substanzen geschult. Auch die optimale pflegerische Versorgung unserer Patienten nach einer Behandlung mit dem HIPEC-Verfahren wird durch regelmäßige Schulungen unserer Pflegekräfte gesichert.
Weitere spezialisierte Informationen zur Therapie und zum Ablauf der Behandlung mit dem HIPEC-Verfahren finden Sie hier.
Zu den hormonproduzierenden Organen gehören die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse, die Nebennieren und die Bauchspeicheldrüse = Pankreas.
Umfangreiche Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse können wir dank spezieller Verfahren und der notwendigen fachübergreifenden Überwachung auch älteren Betroffenen sicher anbieten – hier arbeiten wir in unserem Pankreaszentrum eng mit unseren anderen Fachabteilungen zusammen.
Unsere Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam in unserem zertifizierten Pankreaszentrum sowohl gut- als auch bösartige Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse umfassend und qualitätsgesichert.
Siehe auch: Pankreaskarzinom, endokrine Erkrankungen, Schilddrüse & Nebenschilddrüse, Nebennieren
Die Blinddarmentzündung ist eigentlich eine Entzündung des Wurmfortsatzes = Appendix vermiformis. Er ist ein Abschnitt am Beginn des Dickdarms und befindet sich im rechten Unterbauch. Die Appendix gehört zum menschlichen Immun-Abwehrsystem. Bei einer akuten Blinddarmentzündung sind die Schmerzen typischerweise im rechten Unterbauch lokalisiert. Zu den weiteren Symptomen gehören Entzündungszeichen mit Fieber, Erbrechen und Appetitlosigkeit. Allerdings kann eine Blinddarmentzündung auch eher untypische Beschwerden verursachen, die an ein anderes Krankheitsbild denken lassen.
Die Diagnosestellung erfolgt zunächst auf Basis der Beschwerden und der körperlichen Untersuchung. Ergänzend kommen Labor- und eine Ultraschalluntersuchung hinzu.
Die Therapie der akuten Blinddarmentzündung kann antibiotisch oder operativ – in der Regel minimal-invasiv = laparoskopisch erfolgen. Welches Operationsverfahren zur Anwendung kommt, wird in Abhängigkeit von der Befundsituation individuell besprochen. In den meisten Fällen erfolgt die Hautnaht mit mittels eines selbstauflösenden Fadens, der nicht entfernt werden muss. Im Falle eines Blinddarmdurchbruchs = perforierte Appendizitis sind die Therapie und die Therapiedauer vom Umfang der Bauchfellentzündung abhängig.
Das Leistungsspektrum unserer Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie, der Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, der Klinik für Urologie ebenso wie das unserer Klinik für Kinderchirurgie umfasst den gesamten Bereich traditioneller und neuer Operationsverfahren mit und ohne Kunstmaterial. Die besonders schonende laparoskopische Operation = Schlüssellochoperation und auch den Da-Vinci-OP-Roboter setzen wir regelmäßig ein.
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind besondere, chronisch entzündliche Darmerkrankungen – kurz CED. Eine individuell angepasste Kombination der medikamentösen und operativen Behandlung hilft, die Lebensqualität der betroffenen Patient*innen nachhaltig zu sichern.
Hier ist die enge Zusammenarbeit der spezialisierten Therapeuten unentbehrlich. Deshalb stimmen sich unsere Klinik für Allgemeine Innere Medizin & Gastroenterologie – Medizinische Klinik III und die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie eng ab. Unsere exakt abgestimmten Diagnostik- und Behandlungskonzepte erarbeiten wir gemeinsam im Rahmen unserer wöchentlichen Viszeralmedizinkonferenz.
siehe auch: Colitis ulcerosa & Morbus Crohn
Colitis ulcerosa zählt ebenso wie Morbus Crohn zu den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen – kurz CED. Die Colitis ulcerosa verläuft meist in Schüben. Das bedeutet, es gibt beschwerdefreie Phasen und Krankheitsphasen, die sich abwechseln. In den Krankheitsphasen entzündet sich die Darmschleimhaut akut – als Folge der Entzündung bilden sich Wunden = Geschwüre. Meist beginnt die Entzündung bei der Colitis ulcerosa im End- und Mastdarm, dem letzten Abschnitt des Dickdarms. Sie kann sich jedoch auf weitere Dickdarmabschnitte ausbreiten. Erstreckt sie sich auch auf den links gelegenen Dickdarm, spricht man von einer Linksseitencolitis. Ist der gesamte Dickdarm befallen, spricht man von einer Pancolitis. Je nach Ausdehnung der Colitis nimmt die Schwere der Symptome zu. Eine zuverlässige Methode zum Nachweis der Colitis ulcerosa und zur Bestimmung ihrer Ausdehnung ist z.B. eine Darmspiegelung = Koloskopie. Häufige Symptome für die Erkrankung sind unter anderem blutige, schleimige Durchfälle, Gewichtsverlust und Bauchschmerzen.
Die Colitis ulcerosa erfordert ein abgestuftes Behandlungskonzept. Häufig kann die Erkrankung mit Hilfe von Medikamentengaben erfolgreich behandelt bzw. kontrolliert werden. Nur in wenigen, schwer verlaufenden Fällen mit nicht erfolgreicher medikamentöse Therapie kann eine Operation erforderlich werden.
Während bei der Colitis ulcerosa nur der Enddarm und eventuell der Dickdarm entzündet sind, betrifft der Morbus Crohn den gesamten Verdauungstrakt – vom Mund bis zum After. Am häufigsten entstehen die Entzündungen jedoch am Übergang des Dünndarms in den Dickdarm. Diese – ebenfalls in Schüben verlaufende – chronisch-entzündliche Darmerkrankung ist nicht heilbar, meist aber gut therapierbar. Morbus Crohn kann verschiedenste Symptome hervorrufen. Sie ähneln den Symptomen der Colitis ulcerosa. Sie betreffen ebenfalls vor allem den Magen-Darm-Trakt, können sich jedoch auch auf andere Körperregionen erstrecken. Im Unterschied zur Colitis ulcerosa umfasst die Entzündung beim Morbus Crohn meist nicht nur die oberflächliche Darmschleimhaut, sondern alle Schichten der Darmwand. Die Entzündungsherde beim Morbus Crohn hängen in der Regel nicht zusammen, sondern treten abschnittsweise an verschiedenen Stellen des Darms auf. Dazwischen liegen immer wieder gesunde Darmabschnitte. Manchmal bilden sich im Laufe der Erkrankung auch sogenannte Fisteln = Kurzschlussverbindungen von Darm zu Darm oder von Darm zur Haut.
Da der Morbus Crohn individuell sehr verschieden verläuft, lassen sich keine allgemeinen Aussagen zur Prognose treffen. Zu beachten ist, dass durch die Erkrankung an Morbus Crohn das Risiko an Darmkrebs zu erkranken erhöht ist.
Unsere Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam in unserem zertifizierten Darmkrebszentrum Patienten mit Darm- und Darmkrebserkrankungen. Die Versorgung umfasst die Diagnostik, die Operation und die medikamentöse Therapie.
Die wichtigsten Indikationen für die Spiegelung des Dickdarms = Koloskopie ist die Suche nach Polypen, um die Entstehung von Darmkrebs zu vermeiden – oder bei Verdacht auf bereits vorliegenden Darmkrebs. Die Ileo-Koloskopie nutzen wir, um die Ursachen von Durchfallerkrankungen und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu erkennen. Durch die Darmspiegelung können Krankheitsverläufe beurteilt und die richtigen Therapien gefunden werden. Auch für die Krebsvorsorge bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen ist die Darmspiegelung eine wichtige Untersuchungsmethode. Aufdehnungen = Dilatationen von Engstellen im Dickdarm und im Übergang von Dickdarm zu Dünndarm werden hier regelmäßig vorgenommen.
Die Darmspiegelung erfolgt in aller Regel nach einer kurz wirksamen Schlafspritze unter leitliniengerechter Überwachung.
Unsere Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam in unserem zertifizierten Darmkrebszentrum Patienten mit Darm- und Darmkrebserkrankungen. Die Versorgung umfasst die Diagnostik, die Operation und die medikamentöse Therapie.
Siehe auch: Erkrankungen an Dick-, Mast- & Enddarm, Darmkrebs
Durch den Dick- und Enddarm werden die von unserem Körper zu Stuhl verarbeiteten Reste unserer Ernährung ausgeschieden. Der Dickdarm ist mit besonders vielen Bakterien besiedelt. Sie bilden die Darmflora und sind auch für das Immunsystem von großer Bedeutung. Das Bakteriengefüge im Dick- und Enddarm ist sehr empfindlich. Daher zählen gut- aber auch bösartige Erkrankungen des Dickdarms und des Mastdarms zu den häufigsten Erkrankungen im Bauchraum.
Zu den Symptomen einer Darmerkrankung zählen beispielsweise Durchfall, Verstopfung, Blähungen oder Blut im Stuhl. Die möglichen Ursachen können Reizdarm, Magen-Darm-Infektionen, chronisch-entzündliche Darmkrankheiten – z.B. Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa (siehe dort) bis hin zu Darmkrebs sein.
Darmerkrankungen lassen oft sich konservativ therapieren, erfordern aber – je nach Diagnose – häufig auch eine operative Behandlung.
Erkrankungen an Dick-, Mast- oder Enddarm = Koloproktologie, die einen operativen Eingriff erfordern, gehören zu den Eingriffen des unteren Gastrointestinaltrakts – kurz UGIT: Zum unteren Gastrointestinaltrakt zählen Dickdarm, Sigma, Mastdarm und Anus. In unserer Klinik für Allgemein-, Viszeral und Onkologische Chirurgie behandeln wir sowohl gut- als auch bösartige Erkrankungen dieser Organe.
Seit 2009 arbeiten wir im Rahmen unseres zertifizierten Darmkrebszentrums eng mit anderen Kliniken unseres Hauses und auch mit externen Partnern zusammen. So stellen wir sicher, dass Patienten, die im Bereich des Darms an Krebs erkrankt sind, vom Zeitpunkt der Diagnose über die Operation, bzw. Therapie bis hin zur Nachsorge umfassend und kompetent betreut werden.
Ist es notwendig, den erkrankten Darmabschnitt operativ zu entfernen, kann dies sowohl konventionell durch eine Schnittoperation als auch minimalinvasiv = laparoskopisch, Schlüssellochoperation erfolgen. Patienten mit Sigmadivertikulitis = gutartige Entzündung des letzten Dickdarmabschnitts, Divertikelkrankheit werden überwiegend mit einer Schlüssellochoperation versorgt und benötigen lediglich einen kurzen stationären Aufenthalt. Bei entzündlichen oder tumorösen Veränderungen im äußersten Abschnitt des Mastdarms = Anus oder bei Stuhlentleerungsstörungen bieten wir nach Spiegelung und Ultraschall des Enddarms spezielle, den Schließmuskel erhaltende, operative Verfahren an.
Eine spezielle Untergruppe bildet die Chirurgie bei Erkrankungen des Enddarms. Bei Hämorrhoidalleiden, Inkontinenz, Vereiterungen des Darmausganges oder Stuhlgangsproblemen hilft häufig eine fachgerechte Operation.
Unsere Klinik für Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie ist darauf spezialisiert, verschiedene Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes zu untersuchen und konservativ zu behandeln. Ist ein operativer Eingriff notwendig, erfolgen die Eingriffe in Zusammenarbeit mit der Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie. Patienten mit Darm- und Darmkrebserkrankungen werden gemeinsam mit den beiden oben genannten Kliniken und der Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie in unserem zertifizierten Darmkrebszentrum behandelt. Die Versorgung umfasst die Diagnostik, die Operation und die medikamentöse Therapie.
Siehe auch: Darmkrebs, Colitis ulcerosa & Morbus Crohn
Die Schilddrüse befindet sich unterhalb des Kehlkopfes vor der Luftröhre. Sie gehört zu den hormonproduzierenden Organen und spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation vieler Körperfunktionen. Zu den hormonproduzierenden Organen gehören die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse, die Nebennieren und die Bauchspeicheldrüse = Pankreas. Erkrankungen der Schilddrüse können sich durch eine diffuse Vergrößerung, eine knotige Umstrukturierung oder durch eine Funktionsstörung des Organs zeigen. Dementsprechend vielseitig sind die Beschwerden.
Die Nebenschilddrüsen sind vier ungefähr erbsengroße Drüsen, die an der Rückseite der Schilddrüse liegen und das sogenannte Parathormon produzieren. Dieses Hormon reguliert den Calciumstoffwechsel.
Die beiden Nebennieren befinden sich oberhalb der rechten und linken Niere im hinteren Bauchraum. Die etwa zwei bis drei cm großen Nebennieren produzieren verschiedene Hormone – beispielsweise Adrenalin, Cortisol und Aldosteron.
Die Milz ist ein ca. faustgroßes lymphatisches Organ und liegt unter dem Rippenbogen im linken Oberbauch. Sie grenzt an den Magen, das Zwerchfell und an die linke Niere. Eine der Hauptaufgaben der Milz ist das Herausfiltern und der Abbau überalterter roter Blutzellen = Erythrozyten. Im Gegensatz zu den Lymphknoten ist die Milz nicht in das Lymphsystem, sondern in den Blutkreislauf eingebunden. Eine funktionierende Milz ist wichtig, aber – vor allem bei Erwachsenen – nicht zwingend lebensnotwendig. Muss sie – z.B. aufgrund eines Unfalls – operativ entfernt werden, übernehmen andere Körperorgane zumindest teilweise ihre Aufgaben. Nach einer solchen Milzentfernung = Splenektomie sind die Betroffenen allerdings häufig anfälliger für Infekte und weisen bei Infektionen mit bestimmten Bakterien ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe auf.
Erkranken die Schilddrüse oder die Nebenschilddrüse, oder bilden sich Tumore in den Nebennieren, ist eine Operation oft die Therapie der Wahl. Sie gibt den Patienten Sicherheit und kann eine dauerhafte körperliche Beeinträchtigung vermeiden. Selbstverständlich besprechen wir diesen Schritt mit unseren Patienten nach einer ausführlichen und differenzierten Diagnostik. Die Endokrine Chirurgie ist die Chirurgie der hormonproduzierenden Organe.
Die Überwachung des Stimmbandnervs während der Schilddrüsenoperation ist bei uns selbstverständlich. Ausgedehnte Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse können wir dank spezieller Verfahren und der notwendigen fachübergreifenden Überwachung auch älteren Betroffenen sicher anbieten – hier arbeiten wir in unserem Pankreaszentrum eng mit anderen Fachabteilungen, z.B. mit der Medizinischen Klinik III, der Gastroenterologie, zusammen. Dies gilt sowohl für chronische Entzündungen als auch für Tumorerkrankungen.
Unsere Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam in unserem zertifizierten Pankreaszentrum sowohl gut- als auch bösartige Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse umfassend und qualitätsgesichert.
Siehe auch: Pankreaskarzinom, endokrine Erkrankungen
Chirurgische Eingriffe an der Leber und den Gallenwegen gehören zur sogenannten Hepatobiliären Chirurgie. Die hepatobiliäre Chirurgie behandelt also gut- und bösartige Erkrankungen der Leber, der Gallenblase und der Gallenwege. Dazu zählen unteren anderem flüssigkeitsgefüllte Zysten, Tumore und Metastasen in der Leber, Gallensteine und Entzündungen oder andere krankhafte Veränderungen in der Galle und den Gallengängen. Diese Erkrankungen erfordern nach einer sorgfältigen Voruntersuchung mit Spiegelung und Röntgendiagnostik häufig eine Operation.
Wir bieten, soweit möglich, standardmäßig sogenannte laparoskopische Operationen = Schlüssellochoperationen an.
Gemeinsam mit unserer Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, der Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und der Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln wir Patienten mit Erkrankungen der Leber, Galle und Gallengang. Die Versorgung umfasst die Diagnostik, die Operation und die medikamentöse Therapie.
Siehe auch: Gallensteine, Gallengangssteine & Gallengangskarzinom
Zur möglichst komplikationsarmen Darstellung und Therapie von Gallenwegserkrankungen bedarf es besonderer Erfahrung. Am häufigsten behandeln wir Steine der Gallengänge und gut- oder bösartige Engstellen.
Verlassen Gallensteine die Gallenblase, gelangen sie über den Gallengang in den Zwölffingerdarm. Dadurch blockieren sie manchmal den Gallengang und verhindern den Abfluss der Gallenflüssigkeit aus der Leber und der Gallenblase. Hierdurch kann es zu einer Gelbsucht = Ikterus oder zu Entzündungen der Gallenwege = Cholangitis, der Gallenblase = Cholezystitis oder der Bauchspeicheldrüse = Pankreatitis kommen. Die Symptome sind häufig: krampfartige rechtsseitige Oberbauchschmerzen, Gelbsucht, Entfärbung des Stuhlgangs, dunkler Urin, Übelkeit und Erbrechen.
Gallengangssteine werden mittels Körbchen oder Ballon entfernt. Außerdem steht im St. Bernward Krankenhaus eine elektrohydraulische Lithotrypsie zur Zertrümmerung der Steine zur Verfügung. Engstellen des Gallengangs werden mittels spezieller Ballons aufgedehnt und anschließend durch Stents überbrückt. Auch Patienten, die an Magen, Bauchspeicheldrüse oder Galle operiert wurden, können häufig mit Hilfe eines Doppelballonenteroskops bis zum Gallengang gespiegelt werden.
Der Gallengangskrebs = Gallengangskarzinom gehört zu den besonders seltenen und bösartigen Tumoren. Er entsteht in den Gallengängen – der Verbindung zwischen Leber, Gallenblase und Dünndarm. Nur bei vollständiger operativer Entfernung im Anfangsstadium ist eine Genesung möglich. Durch die Anwendung einer speziellen Lasertherapie = photodynamischen Therapie behandeln wir Gallengangskarzinome an der Lebergabel – sogenannte Klatskin-Tumore. Alternativ steht auch die Radiofrequenzablation zur Verfügung. Gallenblasenkrebs und Gallengangskrebs verursachen meist erst ab einem fortgeschrittenen Stadium Beschwerden. Meist werden sie zufällig bei Operationen oder Untersuchungen entdeckt. Das liegt vor allem an den unspezifischen Symptomen, die die Diagnose erschweren.
Eine endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie – kurz ERCP – ist ein endoskopisches Verfahren zur Darstellung und Untersuchung der Gallen- und Pankreasgänge. Die Darstellung erfolgt dabei unter Durchleuchtung mit einem Bildwandler nach der Gabe eines Kontrastmittels. So kann auch der Abfluss der Bauchspeicheldrüse in den Dünndarm dargestellt werden. Dieses Verfahren bietet sich zur Abklärung und Behandlung langandauernder Entzündungen der Bauchspeicheldrüse = chronische Pankreatitis an, um den Abfluss der Enzyme der Bauchspeicheldrüse zu verbessern.
Pseudozysten entstehen insbesondere bei und nach Entzündungen der Bauchspeicheldrüse. Hier können große Operation meist vermieden werden, indem die Flüssigkeit in den Magen oder Dünndarm durch eine endosonographisch gesteuerte Drainage oder Nekrosektomie abgeleitet werden.
Unsere Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam Patienten mit Gallensteinen, Gallengangssteinen und Karzinomen. Die Versorgung umfasst die Diagnostik, die Operation und die medikamentöse Therapie.
Operative Therapien
Die Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie ist eine chirurgische Klinik mit viel Erfahrung – denn: operieren ist nicht gleich operieren. In unserer Klinik bieten wir alle gängigen operativen Verfahren an – von der offenen Chirurgie über Hybridoperationen (Kombination von offener und minimalinvasiver Chirurgie) bis hin zu rein laparoskopischen (minimalinvasiven) Verfahren und Da Vinci-Operationen. Die gängigsten OP-Methoden möchten wir Ihnen hier vorstellen:
Die minimalinvasive Chirurgie = MIC, laparoskopische Cirurgie bezeichnet als Oberbegriff operative Eingriffe mit der kleinstmöglichen Verletzung von Haut und Weichteilen. Die sogenannte Schlüssellochtechnik erlaubt über ein hoch spezialisiertes Kamera- und Videosystem einen umfassenden Einblick in die Bauchhöhle und somit die Möglichkeit zu einer direkten operativen Versorgung. Diese ist gleichwertig mit dem früher üblichen Verfahren der Schnittoperation. Bei gut- und bösartigen Erkrankungen operieren wir in der Regel fast die Hälfte der Patienten laparoskopisch, d.h. minimalinvasiv. Aufgrund der kleinen Schnitte haben die meisten Patienten nach der Operation geringere Schmerzen und erholen sich deutlich schneller.
Folgende Eingriffe erfolgen in unserer Klinik in der Regel minimalinvasiv: Entfernung des Blinddarms und der Gallenblase, Darmteilentfernung, Bauchspeicheldrüsenoperation bei Zysten, Leberprobenentnahme, Leberzystenentfernung, Magenteilentfernung, Bruchversorgung.
In unserer Spezialsprechstunde beraten wir Sie gern und klären, ob dieses Operationsverfahren für Sie geeignet ist.
Die offene Chirurgie umfasst Operationen, die nicht unter minimalinvasiven Kriterien erfolgen können – zum Teil aus technischen Gründen oder weil eine sichere und vollständige Behandlung nicht gewährleistet werden kann.
Moderne Operationssäle und -instrumente, gut ausgebildete Mitarbeitende sowie eine enge Zusammenarbeit mit der Anästhesie und den anderen operativen Abteilungen unseres Krankenhauses ermöglichen es uns, Routineeingriffe in der Allgemein-, Viszeral- und Onkologischen Chirurgie sicher und sehr komplikationsarm durchzuführen.
Nach der Operation unterstützen wir unsere Patienten, damit sie so schnell wie möglich ihre Beweglichkeit und Selbstständigkeit wiedererlangen. Auch die Entlassung unserer Patienten planen wir unter Einbeziehung des Umfeldes frühzeitig. Mit diesen Maßnahmen möchten wir Ihren Krankenhausaufenthalt so kurz wie möglich gestalten.
Die Multiviszeralchirurgie umfasst die operative Versorgung mehrerer Organe in einem einzigen Eingriff und die funktionelle Wiederherstellung der lebenswichtigen Organfunktionen.
Eingesetzt wird die Methode bei fortgeschrittenen, nur teilweise heilbaren Tumorerkrankungen. Um das bestmögliche Ergebnis für den Patienten zu erreichen, arbeiten verschiedene Fachbereiche eng zusammen und besprechen Operation und Therapie in einer gemeinsamen Tumorkonferenz.
Dank der schonenden Operationsverfahren in der modernen Viszeralchirurgie sind Eingriffe auch bei älteren Patienten oder bei Patienten mit einer Vielzahl von Begleiterkrankungen möglich.
Das Da Vinci Xi-System ist das derzeit modernste, roboter-assistierte Operationssystem, das den höchsten Standard abbildet. Es ermöglicht unseren Chirurgen ein präzises Operieren – auch bei sehr komplexen Eingriffen.
Das Operationssystem besteht aus einer Arztkonsole, einem Patientenwagen mit vier interaktiven Roboterarmen und einem Videosystemwagen. Letzterer ist mit 3D-Bildgebungstechnologie ausgestattet und ermöglicht die Kommunikation zwischen den drei Geräten.
Der Operateur bzw. die Operateurin bedient die Arztkonsole und steuert mit den Handbewegungen exakt die Bewegungen der Roboterarme. An diesen befinden sich die OP-Instrumente, welche sich deutlich präziser bewegen können als eine menschliche Hand. So erhält der Chirurg bzw. die Chirurgin mehr Bewegungsfreiheiten beim Operieren.
Die Vorteile des Da Vinci Xi im Überblick:
- minimalinvasiv
- ermöglicht sehr präzises Operieren, auch bei komplexen Eingriffen
- blutungsärmer und dadurch schonender für die Patienten
- schnellere Genesung nach der OP
- Prinzipiell kann jede Operation mit Da Vinci Xi erfolgen. Vorrangig wird das System jedoch bei komplexeren Eingriffen eingesetzt, zum Beispiel der Entfernung von Tumoren oder bei Rekonstruktions-Operationen.
Sprechen Sie uns an, wir stehen Ihnen gern für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.
Ist eine Krebserkrankung bereits weit fortgeschritten und eine Heilung nicht mehr möglich, kommt mit der Palliativchirurgie eine spezielle operative Versorgungsmöglichkeit zum Einsatz. Sie dient dazu, die Lebensqualität der Betroffenen zu erhalten und zu verbessern und zum Beispiel Durst und Übelkeit zu vermeiden sowie Schmerzen zu lindern.
So können wir sowohl laparoskopisch (Schlüssellochoperation) als auch konventionell (Schnittoperation) chirurgische Eingriffe vornehmen, zum Beispiel Ernährungssonden, Stuhlableitungen, Portkatheter zur Bewässerung und Entfernung großer, Schmerz auslösender Teile des Tumors. Hierfür kooperieren wir mit dem Onkologischen Zentrum und besprechen die geeignete Therapie in einer gemeinsamen Tumorkonferenz.

Chefarzt | Prof. Dr. med. Jörg Pelz
Leiter Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie
Stellvertretender Ärztlicher Direktor

Sekretariat | Susanne Schwenkler
Tel.: 05121 90-1370 | Fax: 05121 90-1402
E-Mail-Kontakt
Weitere Infos auch in unserer Sprechzeitenübersicht.
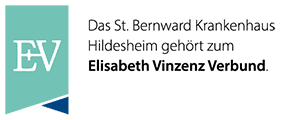
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Text das generische Maskulinum. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir alle Geschlechter ansprechen.