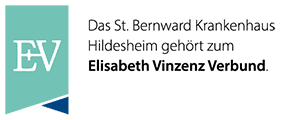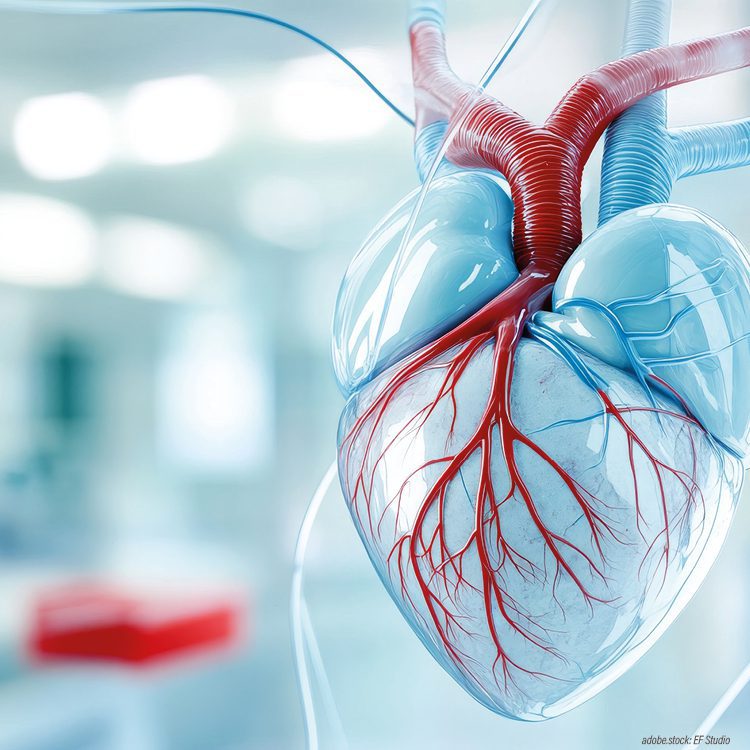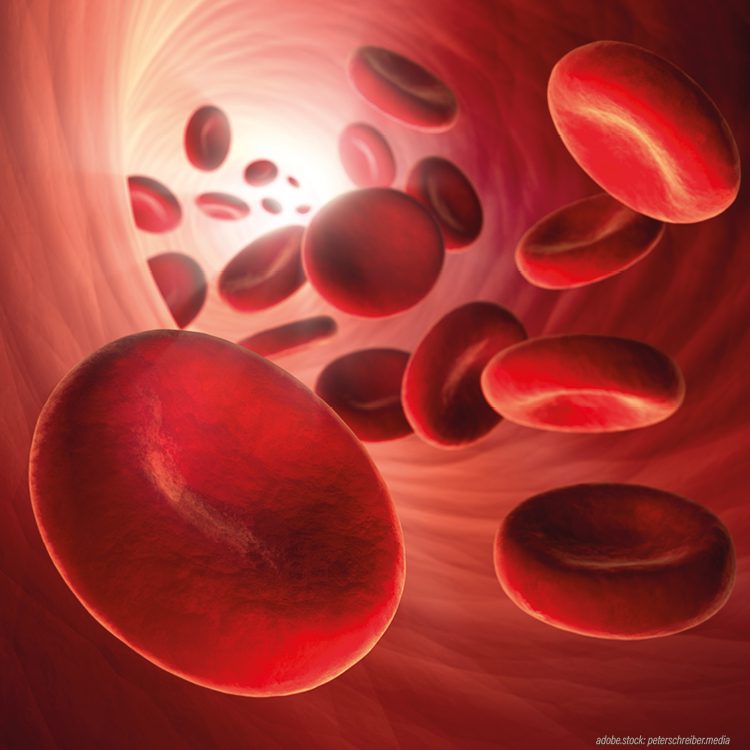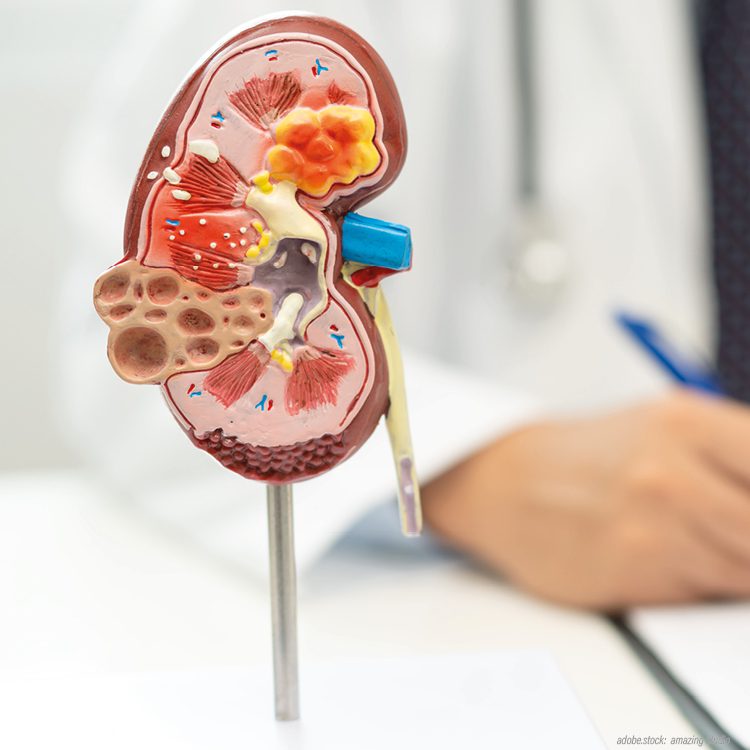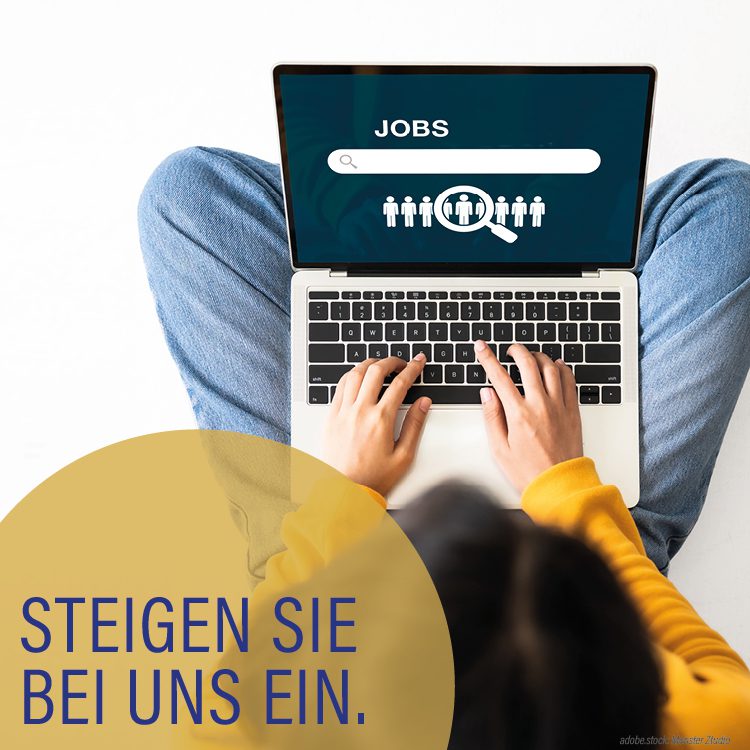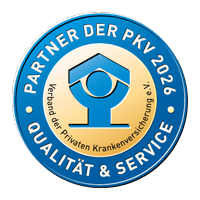Drüsen & innere Organe – Krankheitsbilder schnell gefunden.
Die menschliche Anatomie ist komplex und vielfältig, wobei jedes Organ seine eigene Funktion erfüllt und auf eine spezielle Weise mit anderen Systemen interagiert. Dieses Zusammenspiel kann beeinträchtigt sein. Diese Beeinträchtigungen manifestieren sich manchmal in Form von Erkrankungen.
Die zehn häufigsten Krankheitsbilder von Drüsen und inneren Organen:

Die operative Versorgung von Frühgeborenen oder Säuglingen mit angeborenen oder erworbenen Erkrankungen ist ein Schwerpunkt unserer Klinik für Kinderchirurgie. Häufig werden die Veränderungen, wie Bauchwanddefekte, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, Hydrocephalus oder Spina bifida = offener Rücken bereits vor der Geburt nachgewiesen und das weitere Vorgehen ausführlich besprochen. Beispiele für diese speziellen Behandlungen sind:
- Korrektur angeborener Fehlbildungen des Verdauungstraktes
- Verschluss von Bauchwand-Spalten – Gastroschisis, Omphalozele
- Verschluss von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten – in Kooperation mit PD Dr. Dr. Alexander Gröbe, Diakovere Henriettenstift Hannover; Operation erfolgt im St. Bernward Krankenhaus
- Anlage einer Hirnwasserableitung bei Hydrocephalus – in Kooperation mit Prof. Dr. Kai-Michael Scheufler, Asklepios Kliniken Schildautal Seesen, Operation erfolgt im St. Bernward Krankenhaus
Das Leistungsspektrum unserer Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie, der Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe ebenso wie das unserer Klinik für Kinderchirurgie und der Klinik für Urologie umfasst den gesamten Bereich traditioneller und neuer Operationsverfahren mit und ohne Kunstmaterial. Die besonders schonende laparoskopische Operation = Schlüssellochoperation und auch den Da-Vinci-OP-Roboter setzen wir regelmäßig ein.
Als Bauchfellkrebs oder Peritonealkarzinose wird der Befall der Auskleidung der Bauchraumorgane – des Bauchfells = Peritoneums – mit bösartigen = malignen Tumorzellen bezeichnet. Die Diagnose Bauchfellkrebs steht fast immer für einen komplexen Verlauf einer Krebserkrankung. Es gibt viele auslösende Krebsarten und unterschiedliche Stadien des Befalls. Genauso komplex ist daher die Entscheidungsfindung zur passenden Therapie. In enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Spezialisten aus dem St. Bernward Krankenhaus wie Onkologen, Gynäkologen oder Urologen kann eine sinnvolle, individuelle Therapie geplant und durchgeführt werden. Informieren Sie sich hier weiter zum Thema “Bauchfellkrebs”.
Das Bauchfell = Peritoneum ist von dem griechischen Wort peritonaion = das Ausgespannte abgeleitet und besteht aus einer dünnen Haut, die den Bauchraum von innen auskleidet. Die Oberfläche des Bauchfells ist sehr groß, sie beträgt in etwa eineinhalb bis zwei Quadratmeter. Das Bauchfell umgibt sowohl die Innenseite der Bauchwand (Peritoneum parietale), als auch die Organe des Bauchraumes (Peritoneum viscerale). Das Peritoneum viscerale umschließt dabei die meisten Baucheingeweide. Dieser Teil des Bauchfells produziert die sogenannte Peritonealflüssigkeit, die wie ein Schmiermittel dafür sorgt, dass die Organe im Bauchraum nicht gegeneinander reiben, sondern sich gut bewegen können. Beim Bauchfellkrebs haben sich in dem Organ bösartige Tumorzellen gebildet, die aber nur sehr selten im Bauchfell selbst entstanden sind. In den meisten Fällen handelt es sich bei diesen Krebszellen um Tochtergeschwülste (Metastasen) von fortgeschrittenen bösartigen Tumoren, die in anderen Organen innerhalb des Bauchraums sitzen, den sogenannten Primärtumoren. Durch die vom Bauchfell produzierte Peritonealflüssigkeit, die das Gleiten der Darmschlingen unterstützt, können sich die in den Primärtumoren entstandenen Krebszellen im Bauchraum ausbreiten und schließlich das Bauchfell oder andere Organe befallen. Oft beobachtet man diese Ausbreitung bei gastrointestinalen Krebserkrankungen wie Dickdarmkrebs = kolorektales Karzinom, Dünndarmkrebs und bösartigen Geschwülsten an der Bauchspeicheldrüse = Pankreaskarzinom sowie bei Eierstockkrebs = Ovarialkarzinom.
In seltenen Fällen können auch Tumore außerhalb des Bauchraums, beispielsweise Tumore der Brustdrüse, Bauchfellkrebs verursachen. Denn jeder Tumor, der über die Begrenzungen seines Ursprungsorgans hinauswächst, kann bösartige Zellen in den Bauchraum aussenden. Diese Zellen können sich am Bauchfell festsetzen, dort weiterwachsen und schließlich Tumorknoten bilden.
Beim Bauchfellkrebs wird zwischen zwei Arten unterschieden:
Diffuse Karzinose: Von einer diffusen Karzinose wird gesprochen, wenn sich die Tumorknoten im gesamten Bauchraum oder auch auf der Oberfläche anderer Bauchorgane gebildet haben.
Lokalisierte Karzinose: Bei einer lokalisierten Karzinose haben sich einzelne Tumorknoten auf einem begrenzten Gebiet gebildet und sich noch nicht weiter ausgebreitet.
Symptome
Zu Beginn der Erkrankung klagen viele Patienten über Verstopfung = Obstipation oder Bauchschmerzen = Abdominalschmerzen, die oft mit Hausmitteln behandelt werden. Wenn sich die Tumorzellen immer weiter ausbreiten, kommt es in den meisten Fällen zu Funktionsstörungen der Organe innerhalb des Bauchraums. Dies können sein: Einschränkungen der Darmtätigkeit, Darmverschlüsse = Subileus und Ileus, Probleme beim Wasserlassen = Ischurie, Bildung von Bauchwasser = Aszites, Übelkeit, Völlegefühl, Appetitlosigkeit und Brechreiz sind oft weitere Begleiterscheinungen.
Diagnosestellung
Ob ein Patient an Bauchfellkrebs erkrankt ist, wird in den meisten Fällen mit Hilfe einer Computertomographie festgestellt. Um die Tumorzellen sichtbar zu machen, kommen bei der Computertomographie Kontrastmittel zum Einsatz. Der Ursprung, der Befall und die Ausbreitung der Tumorzellen können stark variieren. Dementsprechend fallen der Krankheitsverlauf und die Prognose für jeden Betroffenen anders aus.
Wie bereits beschrieben, wird von einer limitierten oder lokalisierten Peritonealkarzinose gesprochen, wenn sich die Tumorzellen nur in begrenzten Abschnitten des Bauchfells ausgebreitet haben. Dies betrifft vor allem Organe innerhalb des Bauchraums, die sich nur wenig aktiv selbst bewegen, zum Beispiel den Blinddarm = Zökum oder bei Frauen die tiefste Stelle der Bauchhöhle = Douglas-Raum. Bei der häufiger auftretenden, diffusen Peritonealkarzinose ist das gesamte Bauchfell mit größeren, flächenhaft verstreuten Tumorknoten befallen, zum Teil gilt dies auch für angrenzende Organe. Bis vor kurzem war die Diagnose Bauchfellkrebs gleichbedeutend mit einer kurzen Lebenserwartung, da es sich hierbei um eine sogenannte generalisierte Tumorerkrankung handelt – sprich, ein Krankheitsbild, das den ganzen Körper betrifft. Eine Heilung schien somit ausgeschlossen. Mittlerweile gibt es – dank einer neuen chirurgischen Therapieform, der sogenannten Hyperthermen intraperitonealen Chemotherapie – kurz HIPEC – sehr ermutigende Ergebnisse.
Therapien bei Bauchfellkrebs – welche ist geeignet?
Die Diagnose Bauchfellkrebs steht fast immer für einen komplexen Verlauf einer Krebserkrankung. Es gibt viele auslösende Krebsarten und unterschiedliche Stadien des Befalls. Genauso komplex ist es, die passende Therapie zu finden. Sowohl bei der medikamentösen Behandlung von Bauchfellkrebs mit Chemotherapeutika als auch bei Operations- oder Bestrahlungsmethoden ergeben sich laufend neue Entwicklungen. Die klinische und wissenschaftliche Auswertung und Hinterfragung von Behandlungen und Behandlungsergebnissen haben einen zeitnahen Einfluss auf das Vorgehen von morgen. Entscheidend ist, für den einzelnen Patienten eine individuelle Therapie zu finden, die Risiken und Erfolgschancen nach aktuellen Erkenntnissen gegeneinander abwägt.
Bei der Suche nach der geeigneten Therapieform spielen mehrere Faktoren eine Rolle:
- Untersuchungen mittels bildgebender Diagnostikmethoden (MRT, CT)
- Befunde aus vorangegangenen Operationen
- Pathologische Berichte und Laborwerte
- allgemeiner körperlicher Zustand
Tumorkonferenz: Viele Spezialisten für einen Patienten
Der Krankheitsverlauf jedes einzelnen Patienten wird in der sogenannten interdisziplinären Tumorkonferenz besprochen. Diese Runde wird von unseren zertifizierten Zentren Onkologisches Zentrum und Darmkrebszentrum einberufen. An der Tumorkonferenz nehmen Ärzte verschiedener Fachrichtungen teil, unter anderem Allgemein-, Viszeral- und onkologische Chirurgen, medizinische Onkologen, Nuklearmediziner, Gynäkologen und Pathologen. Gemeinsam prüfen sie vorliegende Befunde, schätzen anhand der oben genannten Faktoren ein, welche Therapie für den jeweiligen Patienten die individuell am besten geeignete ist und geben eine Empfehlung ab. Erst dann wird die Therapie vorbereitet und eingeleitet.
Behandlung von Bauchfellkrebs im St. Bernward Krankenhaus
Bei der Entscheidung, ob bei einem Patienten mit Bauchfellkrebs = Peritonealkarzinose eine Entfernung des Bauchfells = Peritonektomie in Kombination mit dem HIPEC-Verfahren erfolgen soll, ist eine enge Zusammenarbeit der Chirurgen mit Radiologen, Gynäkologen, Urologen, Onkologen, Intensivmedizinern, Ernährungsberatern und vielen anderen Fachleuten zwingend erforderlich. Auch bei der Betreuung des Patienten nach der Operation ist es wichtig, ein multiprofessionelles, speziell geschultes Team an seiner Seite zu wissen. Das St. Bernward Krankenhaus vereint sämtliche Experten unter einem Dach.
Auch eine Ausstattung mit moderner Medizintechnik, wie das St. Bernward Krankenhaus sie bietet, ist bei einem solch aufwendigen Operationsverfahren unerlässlich. Sämtliche Zytostatika können in unserer hauseigenen Krankenhausapotheke tagesaktuell hergestellt werden. Somit sind eine valide, gesicherte Herstellung sowie kurze Transportwege zum Patienten gewährleistet. Die Behandlung mit dem HIPEC-Verfahren geht mit zahlreichen postoperativen Besonderheiten und Schutzmaßnahmen einher. Da Zytostatika als Gefahrenstoffe gelten, die bei gesunden Menschen als krebserregend eingestuft werden, wird unser medizinisches und pflegerisches Personal regelmäßig im Umgang mit diesen Substanzen geschult. Auch die optimale pflegerische Versorgung unserer Patienten nach einer Behandlung mit dem HIPEC-Verfahren wird durch regelmäßige Schulungen unserer Pflegekräfte gesichert.
Weitere spezialisierte Informationen zur Therapie und zum Ablauf der Behandlung mit dem HIPEC-Verfahren finden Sie hier.
Zu den hormonproduzierenden Organen gehören die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse, die Nebennieren und die Bauchspeicheldrüse = Pankreas.
Umfangreiche Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse können wir dank spezieller Verfahren und der notwendigen fachübergreifenden Überwachung auch älteren Betroffenen sicher anbieten – hier arbeiten wir in unserem Pankreaszentrum eng mit unseren anderen Fachabteilungen zusammen.
Unsere Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam in unserem zertifizierten Pankreaszentrum sowohl gut- als auch bösartige Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse umfassend und qualitätsgesichert.
Siehe auch: Pankreaskarzinom, endokrine Erkrankungen, Schilddrüse & Nebenschilddrüse, Nebennieren
Blasenkrebs = Blasenkarzinom ist ein bösartiger Tumor der Harnblase. Er geht meist von der Schleimhaut der Blase aus. Als Risikofaktoren gelten Rauchen und chemische Stoffe – sogenannte aromatische Amine. Der Blasenkrebs wird meist durch eine Blasenspiegelung erkannt, die aufgrund von schmerzlosem Blut im Urin = Makrohämaturie durchgeführt wird.
Solange der Blasenkrebs auf die Schleimhaut begrenzt ist, lassen sich die Tumore mittels Blasenspiegelung = Zystoskopie abtragen. Behandlung und Heilungschancen des Blasenkrebses hängen also davon ab, wie weit der Tumor bereits in die Blasenwand hineingewachsen ist. Wächst der Tumor nur oberflächlich oder nur geringfügig in die Tiefe, kann er mit einer Elektroschlinge von innen durch eine sogenannte Transurethrale Resektion von Blasengewebe – kurz TUR-B – abgetragen werden. Kann der Blasenkrebs mit einer TUR-B von innen ausgeschält werden, bleibt die eigene Blase erhalten. Bei Tumoren, die bereits bis in die Muskulatur der Blase eingewachsen sind, muss meist die Blase komplett entfernt werden. Der Urin wird dann über eine künstliche Harnableitung = Urostoma in ein Darmteilstück geleitet, das wiederum aus der Haut ausgeleitet wird – durch ein sogenanntes Ileumconduit – oder es wird aus Darm eine neue Blase – eine sogenannte Neoblase – geformt. Diese wird im Körper wieder an die Harnröhre angenäht und sitz so an ursprünglicher Stelle.
Diese Operationen lassen sich auch minimalinvasiv mit dem Da-Vinci-Operationssystem durchführen, sodass die Komplikationsrate und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes stark reduziert werden können.
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Klinik für Urologie im St. Bernward Krankenhaus ist die Behandlung von Patienten mit Blasenkrebs. Hierfür steht uns vor Ort ein hauseigener Da Vinci Xi OP-Roboter zur Verfügung. Alle Patienten werden in Tumorkonferenzen vorgestellt und durch unser Uroonkologisches Zentrum betreut. Eine der Kernkompetenzen unserer Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II ist zudem die medikamentöse Behandlung von Patienten mit Blasenkrebs. Darüber hinaus werden sie im Rahmen unseres zertifizierten Onkologischen Zentrums betreut.
Die Blinddarmentzündung ist eigentlich eine Entzündung des Wurmfortsatzes = Appendix vermiformis. Er ist ein Abschnitt am Beginn des Dickdarms und befindet sich im rechten Unterbauch. Die Appendix gehört zum menschlichen Immun-Abwehrsystem. Bei einer akuten Blinddarmentzündung sind die Schmerzen typischerweise im rechten Unterbauch lokalisiert. Zu den weiteren Symptomen gehören Entzündungszeichen mit Fieber, Erbrechen und Appetitlosigkeit. Allerdings kann eine Blinddarmentzündung auch eher untypische Beschwerden verursachen, die an ein anderes Krankheitsbild denken lassen.
Die Diagnosestellung erfolgt zunächst auf Basis der Beschwerden und der körperlichen Untersuchung. Ergänzend kommen Labor- und eine Ultraschalluntersuchung hinzu.
Die Therapie der akuten Blinddarmentzündung kann antibiotisch oder operativ – in der Regel minimal-invasiv = laparoskopisch erfolgen. Welches Operationsverfahren zur Anwendung kommt, wird in Abhängigkeit von der Befundsituation individuell besprochen. In den meisten Fällen erfolgt die Hautnaht mit mittels eines selbstauflösenden Fadens, der nicht entfernt werden muss. Im Falle eines Blinddarmdurchbruchs = perforierte Appendizitis sind die Therapie und die Therapiedauer vom Umfang der Bauchfellentzündung abhängig.
Das Leistungsspektrum unserer Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie, der Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, der Klinik für Urologie ebenso wie das unserer Klinik für Kinderchirurgie umfasst den gesamten Bereich traditioneller und neuer Operationsverfahren mit und ohne Kunstmaterial. Die besonders schonende laparoskopische Operation = Schlüssellochoperation und auch den Da-Vinci-OP-Roboter setzen wir regelmäßig ein.
Der Brustkrebs = Mammakarzinom ist eine bösartige Krebserkrankung des Brustgewebes und die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Häufig sind Frauen nach der Menopause = Wechseljahre betroffen. Wird der Brustkrebs frühzeitig entdeckt, kann er häufig geheilt werden. Daher sollten Frauen jeden Alters die Brustkrebs-Symptome kennen, auf sie achten und alle Möglichkeiten der Früherkennung nutzen. Bei Frauen ab 50 Jahren übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Früherkennungsuntersuchungen. Auch Männer können – wenn auch deutlich seltener – an Brustkrebs erkranken.
Dennoch bedeutet nicht jede Veränderung im Brustgewebe eine Krebserkrankung. Verhärtungen, Schwellungen oder Knoten können auch harmlose Ursachen haben. Moderne Untersuchungsverfahren ermöglichen das frühzeitige Erkennen der Vorstufen – auch wenn sich aus diesen keinesfalls zwangsläufig Brustkrebs entwickeln muss. Ob und wie eine mögliche Behandlung erfolgt, hängt von der Art der Veränderung und dem persönlichen Brustkrebsrisiko der Betroffenen ab. Symptome wie z.B. Verhärtungen oder Knoten in den Brüsten oder den Achselhöhlen, Hautveränderungen – z.B. Rötungen, Entzündungen oder Orangenhaut –, schmerzhafter oder nicht schmerzhafter Juckreiz der Brust, Veränderungen der Farbe oder Form der Brustwarzen oder Absonderung von Flüssigkeiten sollten jedoch schnellstmöglich fachärztlich abgeklärt werden.
Brustkrebs wird nach Entstehungsort und Stadium der Erkrankung unterteilt. Am häufigsten ist das sogenannte duktale Mammakarzinom – es entsteht in den Milchgängen. Hat der Brustkrebs seinen Entstehungsort in den Milchdrüsen, handelt es sich um das – deutlich seltenere – lobuläre Mammakarzinom. Die vier Einteilungsstadien des Brustkrebses zeigen auf, wie weit fortgeschritten die Erkrankung ist. Die Einteilung erfolgt nach der Größe des Tumors = Abkürzung T, der Beteiligung von Lymphknoten = Abkürzung N und dem Vorhandensein von Fernmetastasen = Abkürzung M.
Es gibt zahlreiche unterschiedliche Formen von Brustkrebs. Die konkreten Merkmale werden mittels spezieller Untersuchungen diagnostiziert – sie sind entscheidend für die jeweilige Therapie. So wachsen z.B. manche Brustkrebsarten unter dem Einfluss des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen. Entsprechende Medikamente blockieren die Wirkung des Hormons und erlauben so eine sehr erfolgreiche Behandlung dieser Brustkrebsformen. Andere Brustkrebse weisen spezifische Angriffspunkte, z.B. auf molekularer Ebene, auf. Diese erlauben eine zielgerichtete Therapie oder Immuntherapie.
Brustkrebs entsteht durch die Veränderungen des Erbguts gewöhnlicher Körperzellen: Die Körperzellen entarten und verlieren dadurch ihre spezifische Struktur und Funktion. In der Folge vermehren sie sich unkontrolliert und führen zum Wachstum von Krebs. Zu den Risikofaktoren zählen u.a. erbliche Veranlagung, Übergewicht = Adipositas, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Diabetes mellitus Typ II = Zuckerkrankheit, schädlicher Genussmittelkonsum, eine Hormonersatztherapie nach dem 50. Lebensjahr und dichtes Brustgewebe, dh. wenig Fett- dafür mehr Drüsen- und Bindegewebe. Häufig treten Brustkrebserkrankungen bei Frauen in der Altersspanne zwischen 50 und 70 Jahren auf. Zudem gilt das Risiko an einem Mammakarzinom zu erkranken bei Kinderlosigkeit, Erstgeburten nach dem 32. Lebensjahr, frühzeitigem Einsetzen der ersten Regelblutung und der späte Beginn der Wechseljahre als geringfügig erhöht.
Das Therapiekonzept des Mammakarzinoms hängt von dessen Stadium zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, der Lage des Tumors und den Eigenschaften der Krebszellen ab. Dank der Früherkennungsuntersuchungen wird Brustkrebs häufig in einem Stadium mit guten Heilungsaussichten entdeckt. Für die Wahl der Therapieverfahren spielen aber auch Vorerkrankungen, das Alter und der allgemeine Gesundheitszustand eine Rolle.
In Frage kommen – neben einer Operation – Strahlentherapie, Chemotherapie, Hormonblockade- oder Immuntherapien
Wenn irgend möglich, ist die brusterhaltende Operation die Therapie der ersten Wahl. Sie wird häufig mit anderen Therapieverfahren – z.B. der Strahlentherapie, der Chemotherapie oder anderen zielgerichteten Therapien kombiniert. Unter Umständen ist es auch – für eine schonendere Operationsmöglichkeit – erforderlich, große Mammatumore mithilfe anderer Therapien vor der Operation zu verkleinern. Im Rahmen der Operation werden Lymphknoten im Achselbereich entfernt und auf den Befall mit Krebszellen untersucht.
Ist eine Operation nicht möglich, kann eine Strahlentherapie zur Zerstörung des Mammakarzinoms eingesetzt werden – in frühen Stadien kann diese auch eine Heilung erreichen. Nach einer brusterhaltenden Operation wird die Strahlentherapie eingesetzt, um Rückfälle durch unerkanntes restliches Krebsgewebe zu verhindern. In fortgeschrittenen Stadien kann die Strahlentherapie große Tumoren verkleinern und so eine Operation erst ermöglichen.
Die Chemotherapie bekämpft Krebszellen, die durch die Operation oder eine Bestrahlung nicht entfernt werden konnten. Die Chemotherapie wird als systemische Therapie eingesetzt, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Brustkrebs unerkannt gestreut hat oder bereits Metastasen = Tochtergeschwulste festgestellt wurden.
Ein erheblicher Anteil der Mammakarzinome wächst unter dem Einfluss des Geschlechtshormons Östrogen. Durch die Gabe hormonblockierender Medikamente kann die Wirkung des Östrogens auf den Brustkrebs blockiert und der Brustkrebs bekämpft werden. Diese sogenannte Hormonblockadertherapie kann auch in Kombination mit anderen Therapien zum Einsatz kommen.
Einige Brusttumore lassen durch die Gabe spezieller Medikamente zerstören bzw. am Wachstum hindern. Diese sogenannten zielgerichteten Therapien sind jedoch nur dann wirksam, wenn der Brustkrebs entsprechende Angriffspunkte aufweist, dh. auf sie reagiert. Ob eine solche Therapie in Betracht kommt, wird durch die Untersuchung von Gewebeproben festgestellt.
Das körpereigene Immunsystem erkennt und zerstört Krebszellen in der Regel, bevor sich ein Brustkrebs entwickelt. Einige Krebszellen täuschen oder blockieren jedoch das Immunsystem – sie werden nicht als Krebszellen erkannt und somit nicht zerstört. Spezielle Immuntherapien schalten die Abwehrmechanismen der Krebszellen aus, so dass das körpereigene Immunsystem das Mammakarzinom bekämpfen kann.
Im Anschluss an die medizinische Behandlung gehören regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen unbedingt zur Therapie des Mammakarzinoms. Eine medizinische Rehabilitation – kurz: Reha – hilft den Betroffenen meist dabei, wieder in den Alltag zu finden. Bei der Beantragung unterstützt unser Sozial- und Entlassmanagement gern.
All diese Therapien haben Nebenwirkungen und Risiken. Deshalb ist eine sorgfältige Anamnese und eingehende Diagnostik elementar wichtig, um die bestmögliche Auswahl und Kombination der Verfahren zu gewährleisten.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind besondere, chronisch entzündliche Darmerkrankungen – kurz CED. Eine individuell angepasste Kombination der medikamentösen und operativen Behandlung hilft, die Lebensqualität der betroffenen Patient*innen nachhaltig zu sichern.
Hier ist die enge Zusammenarbeit der spezialisierten Therapeuten unentbehrlich. Deshalb stimmen sich unsere Klinik für Allgemeine Innere Medizin & Gastroenterologie – Medizinische Klinik III und die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie eng ab. Unsere exakt abgestimmten Diagnostik- und Behandlungskonzepte erarbeiten wir gemeinsam im Rahmen unserer wöchentlichen Viszeralmedizinkonferenz.
siehe auch: Colitis ulcerosa & Morbus Crohn
Colitis ulcerosa zählt ebenso wie Morbus Crohn zu den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen – kurz CED. Die Colitis ulcerosa verläuft meist in Schüben. Das bedeutet, es gibt beschwerdefreie Phasen und Krankheitsphasen, die sich abwechseln. In den Krankheitsphasen entzündet sich die Darmschleimhaut akut – als Folge der Entzündung bilden sich Wunden = Geschwüre. Meist beginnt die Entzündung bei der Colitis ulcerosa im End- und Mastdarm, dem letzten Abschnitt des Dickdarms. Sie kann sich jedoch auf weitere Dickdarmabschnitte ausbreiten. Erstreckt sie sich auch auf den links gelegenen Dickdarm, spricht man von einer Linksseitencolitis. Ist der gesamte Dickdarm befallen, spricht man von einer Pancolitis. Je nach Ausdehnung der Colitis nimmt die Schwere der Symptome zu. Eine zuverlässige Methode zum Nachweis der Colitis ulcerosa und zur Bestimmung ihrer Ausdehnung ist z.B. eine Darmspiegelung = Koloskopie. Häufige Symptome für die Erkrankung sind unter anderem blutige, schleimige Durchfälle, Gewichtsverlust und Bauchschmerzen.
Die Colitis ulcerosa erfordert ein abgestuftes Behandlungskonzept. Häufig kann die Erkrankung mit Hilfe von Medikamentengaben erfolgreich behandelt bzw. kontrolliert werden. Nur in wenigen, schwer verlaufenden Fällen mit nicht erfolgreicher medikamentöse Therapie kann eine Operation erforderlich werden.
Während bei der Colitis ulcerosa nur der Enddarm und eventuell der Dickdarm entzündet sind, betrifft der Morbus Crohn den gesamten Verdauungstrakt – vom Mund bis zum After. Am häufigsten entstehen die Entzündungen jedoch am Übergang des Dünndarms in den Dickdarm. Diese – ebenfalls in Schüben verlaufende – chronisch-entzündliche Darmerkrankung ist nicht heilbar, meist aber gut therapierbar. Morbus Crohn kann verschiedenste Symptome hervorrufen. Sie ähneln den Symptomen der Colitis ulcerosa. Sie betreffen ebenfalls vor allem den Magen-Darm-Trakt, können sich jedoch auch auf andere Körperregionen erstrecken. Im Unterschied zur Colitis ulcerosa umfasst die Entzündung beim Morbus Crohn meist nicht nur die oberflächliche Darmschleimhaut, sondern alle Schichten der Darmwand. Die Entzündungsherde beim Morbus Crohn hängen in der Regel nicht zusammen, sondern treten abschnittsweise an verschiedenen Stellen des Darms auf. Dazwischen liegen immer wieder gesunde Darmabschnitte. Manchmal bilden sich im Laufe der Erkrankung auch sogenannte Fisteln = Kurzschlussverbindungen von Darm zu Darm oder von Darm zur Haut.
Da der Morbus Crohn individuell sehr verschieden verläuft, lassen sich keine allgemeinen Aussagen zur Prognose treffen. Zu beachten ist, dass durch die Erkrankung an Morbus Crohn das Risiko an Darmkrebs zu erkranken erhöht ist.
Unsere Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam in unserem zertifizierten Darmkrebszentrum Patienten mit Darm- und Darmkrebserkrankungen. Die Versorgung umfasst die Diagnostik, die Operation und die medikamentöse Therapie.
Der Dickdarm besteht aus mehreren Abschnitten: Das Zökum ist ein kurzes Stück Darmstück im rechten Unterbauch – mit einem kleinen Anhängsel, dem Wurmfortsatz oder Blinddarm = Appendix vermiformis. Das Kolon = Dickdarm besteht aus aufsteigenden, quer verlaufenden = Querkolon und absteigenden Darmschlingen und dem Sigmoid, das in den Mast- und Enddarm = Rektum übergeht. Der Darm ist – neben der Verdauung – wichtig für die Immunabwehr.
Der Dickdarmkrebs gehört zu den häufigsten Tumorerkrankungen. Meist handelt es sich dabei um Dickdarm- oder Mastdarmkrebs = Kolorektalkarzinom. Dünndarmkrebs kommt eher selten vor. Häufig hat der Tumor zum Zeitpunkt der Diagnosestellung bereits gestreut, d.h. Tochtergeschwüre = Metastasen gebildet.
Die linke Seite des Darms ist häufiger betroffen als die rechte. Die meisten Darmtumore entwickeln sich im absteigenden Teil des Kolons, im Sigmoid oder im Rektum. Sehr häufig entsteht Darm- und Mastdarmkrebs aus gutartigen Vorstufen – sogenannten Polypen = Aussackungen in der Darmschleimhaut. Bei den Polypen handelt es sich meist um Adenome, d.h. gutartige drüsige Wucherungen. Diese Adenome können im Laufe der Zeit entarten und gefährlich werden. Ihre frühzeitige Entdeckung und Entfernung – etwa im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung = Vorsorgekoloskopie beim Gastroenterologen – verhindert die Entstehung eines Großteils kolorektaler Karzinome.
Wird Darmkrebs diagnostiziert, sind Therapie und Heilungschancen von einigen Faktoren abhängig: Das Tumorstadium gibt an, wie tief der Tumor in die Darmwand eingedrungen ist, ob Lymphknoten befallen sind und ob Metastasen vorliegen. Nur wenige Darmtumoren werden im Stadium I entdeckt, da sie fast nie Symptome verursachen. Der überwiegende Teil der Darmtumore wird erst im Stadium II oder III entdeckt. In beiden Stadien hat der Krebs bereits alle Wandschichten des Darms befallen = Stadium II oder sogar auf benachbarte Lymphknoten ausgedehnt = Stadium III. Darmkrebs streut = metastasiert über das Blut vor allem in die Leber und die Lunge. Über die Lymphgefäße gelangen die Krebszellen vor allem aber auch in nahe gelegene Lymphknoten und befallen durch direkte Ausbreitung das Bauchfell.
Gemeinsam mit unserer Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, der Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie der Klinik für Urologie und der Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe behandeln wir in unserem zertifizierten Darmkrebszentrum Patienten mit Darm- und Darmkrebserkrankungen. Die Versorgung umfasst die Diagnostik, die Operation und die medikamentöse Therapie.
siehe auch: Erkrankungen an Dick-, Mast- & Enddarm
Endokrine Erkrankungen sind Erkrankungen der hormonell aktiven Organe = endokrinen Organe. Sie können in unterschiedlichen Bereichen im Körper auftreten. Am bekanntesten – und auch am häufigsten betroffen – sind dabei Schilddrüse und Nebenschilddrüse. Aber auch die Nebennieren können durch ihre Funktion der Produktion verschiedener Hormone unterschiedlichste Erkrankungen auslösen. Der Bereich der endokrinen Erkrankungen ist weit gefasst und unterscheidet sich sehr bezüglich der auftretenden Symptome, der Diagnostik und der Therapie. Zu den endokrinen Störungen gehören z.B. Diabetes mellitus, Hypo- und Hyperthyreose = Schilddrüsenüber- und -Schilddrüsenunterfunktion, Morbus Cushing, die Addison-Krankheit, Kleinwüchsigkeit bei Kindern und der Hyperparathyreoidismus = Überfunktion der Nebenschilddrüsen aber auch weitere hormonelle Störungen.
Diabetes mellitus ist ein Sammelbegriff für vielfältige Störungen des menschlichen Stoffwechsels. Hauptmerkmal ist eine chronische = anhaltende Hyperglykämie = Überzuckerung und er beruht auf einer Insulinresistenz oder einem Insulinmangel. Die Stoffwechselstörung ist mit einem deutlich erhöhten Risiko für schwere Begleit- und Folgeerkrankungen verbunden. Das lebensnotwendige Stoffwechselhormon Insulin steuert den Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsel im Körper.
Der Diabetes mellitus Typ 2 ist die am häufigsten auftretende Diabetes-Form. Kennzeichnend für diesen Diabetestyp ist die verminderte Wirkung des Insulins in den Körperzellen =Insulinresistenz. Sie ist gleichzeitig gekoppelt mit einem Insulinmangel. Dieser Diabetestyp geht meist mit Fettleibigkeit = Adipositas einher.
Der seltenere Diabetes mellitus Typ 1 ist eine Autoimmun-Erkrankung. Im Rahmen dieser Erkrankung werden die insulinbildenden Zellen der Bauchspeicheldrüse durch das körpereigene Abwehrsystem zerstört. Der Körper produziert kein Insulin mehr und es kommt zu einem absoluten Insulinmangel. Die Betroffenen müssen daher lebenslang Insulin spritzen. Durch eine ausgewogene Insulingabe, in Kombination mit einer bestimmten Ernährung, werden Folgeerkrankungen an Gefäßen und Nerven weitgehend verhindert oder deutlich verzögert.
Für eine umfassende, erfolgreiche Diagnostik und Therapie endokriner Erkrankungen gemäß der nationalen und europäischen Leitlinie gewährleisten wir eine enge Zusammenarbeit der Spezialisten aus unseren Kliniken für Allgemeine Innere Medizin & Gastroenterologie – Medizinische Klinik III, Diagnostische & interventionelle Radiologie & Neuroradiologie, Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie – inklusive endokrine Chirurgie für eine individuelle, umfassende Patientenbetreuung.
Siehe auch Schilddrüsen-Erkrankungen – Hypo- und Hyperthyreose
Häufig gesuchte Krankheitsbilder.
Lassen Sie sich häufige Erkrankungen über die Abbildungen anzeigen oder suchen Sie Krankheitsbilder über unser alphabetisches Glossar.