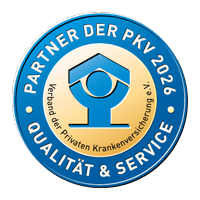Unsere Schwerpunkte
– Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II
Die Medizinische Klinik II ist die zentrale Klinik des zertifizierten Onkologischen Zentrums am St. Bernward Krankenhaus. Die Klinik koordiniert die Behandlung von Patienten mit Krebserkrankungen – denn häufig sind ein fachübergreifendes Vorgehen und die Zusammenarbeit vieler Kliniken und Disziplinen erforderlich.
In unserer fachübergreifenden Tumorkonferenz erarbeiten wir individuelle und patientengerechte Empfehlungen. Neben internistischen Onkologen nehmen regelmäßig Pathologen, Strahlentherapeuten, Allgemein- und Viszeralchirurgen, Orthopäden, Thoraxchirurgen, Pulmologen, Gynäkologen, Gastroenterologen, Urologen und Radiologen teil. Dadurch gewährleisten wir, dass auch Patienten mit komplexen Tumorerkrankungen eine individuell ausgerichtete Behandlung erhalten.
Kernkompetenzen
Zu den hormonproduzierenden Organen gehören die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse, die Nebennieren und die Bauchspeicheldrüse = Pankreas.
Umfangreiche Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse können wir dank spezieller Verfahren und der notwendigen fachübergreifenden Überwachung auch älteren Betroffenen sicher anbieten – hier arbeiten wir in unserem Pankreaszentrum eng mit unseren anderen Fachabteilungen zusammen.
Unsere Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam in unserem zertifizierten Pankreaszentrum sowohl gut- als auch bösartige Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse umfassend und qualitätsgesichert.
Siehe auch: Pankreaskarzinom, endokrine Erkrankungen, Schilddrüse & Nebenschilddrüse, Nebennieren
Blasenkrebs = Blasenkarzinom ist ein bösartiger Tumor der Harnblase. Er geht meist von der Schleimhaut der Blase aus. Als Risikofaktoren gelten Rauchen und chemische Stoffe – sogenannte aromatische Amine. Der Blasenkrebs wird meist durch eine Blasenspiegelung erkannt, die aufgrund von schmerzlosem Blut im Urin = Makrohämaturie durchgeführt wird.
Solange der Blasenkrebs auf die Schleimhaut begrenzt ist, lassen sich die Tumore mittels Blasenspiegelung = Zystoskopie abtragen. Behandlung und Heilungschancen des Blasenkrebses hängen also davon ab, wie weit der Tumor bereits in die Blasenwand hineingewachsen ist. Wächst der Tumor nur oberflächlich oder nur geringfügig in die Tiefe, kann er mit einer Elektroschlinge von innen durch eine sogenannte Transurethrale Resektion von Blasengewebe – kurz TUR-B – abgetragen werden. Kann der Blasenkrebs mit einer TUR-B von innen ausgeschält werden, bleibt die eigene Blase erhalten. Bei Tumoren, die bereits bis in die Muskulatur der Blase eingewachsen sind, muss meist die Blase komplett entfernt werden. Der Urin wird dann über eine künstliche Harnableitung = Urostoma in ein Darmteilstück geleitet, das wiederum aus der Haut ausgeleitet wird – durch ein sogenanntes Ileumconduit – oder es wird aus Darm eine neue Blase – eine sogenannte Neoblase – geformt. Diese wird im Körper wieder an die Harnröhre angenäht und sitz so an ursprünglicher Stelle.
Diese Operationen lassen sich auch minimalinvasiv mit dem Da-Vinci-Operationssystem durchführen, sodass die Komplikationsrate und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes stark reduziert werden können.
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Klinik für Urologie im St. Bernward Krankenhaus ist die Behandlung von Patienten mit Blasenkrebs. Hierfür steht uns vor Ort ein hauseigener Da Vinci Xi OP-Roboter zur Verfügung. Alle Patienten werden in Tumorkonferenzen vorgestellt und durch unser Uroonkologisches Zentrum betreut. Eine der Kernkompetenzen unserer Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II ist zudem die medikamentöse Behandlung von Patienten mit Blasenkrebs. Darüber hinaus werden sie im Rahmen unseres zertifizierten Onkologischen Zentrums betreut.
Lungenkrebs = Bronchialkarzinom ist ein bösartiger Tumor in der Lunge. Unterschieden wird der Lungenkrebs, der direkt = primär in der Lunge entstanden ist, und den sogenannten Lungenmetastasen. Bei den Lungenmetastasen liegt der Ursprung oft in einer Krebserkrankung eines anderen Organs – z.B. bilden Brust- oder Prostatakrebserkrankungen häufig Metastasen in der Lunge.
Grundsätzlich werden zwei Formen von Lungenkrebs unterschieden: das häufigere nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom und das seltenere kleinzellige Bronchialkarzinom. Letzteres wächst schneller und aggressiver. Da der Lungenkrebs häufig erst sehr spät Symptome verursacht, ist er besonders gefährlich. Oft ist er dann bereits weiter fortgeschritten und hat Metastasen in anderen Organen gebildet. Bemerkbar macht sich der bösartige Tumor in der Lunge meist durch hartnäckigen Husten und Kurzatmigkeit. Häufig werden diese Symptome allerdings als Atemwegsinfekt oder Bronchitis gedeutet.
Ein Bronchialkarzinom lässt sich mit einer Operation, Bestrahlung und einer medikamentösen Therapie häufig erfolgreich behandeln. Durch die fortschreitende Entwicklung in der medizinischen Forschung kann die Behandlung zunehmend individuell angepasst erfolgen. Chemotherapien, Immuntherapien und Medikamente können auf bestimmte Merkmale des Tumors ausgerichtet werden.
Wie bei jeder Krebserkrankung gilt auch für den Lungenkrebs: Je früher er diagnostiziert und behandelt wird, desto höher sind die Genesungs- und Überlebenschancen.
Risikofaktoren, die die Entstehung von Lungenkrebs begünstigen, sind – neben dem Rauchen – das Einatmen von Stäuben, Chemikalien und anderen Schadstoffen. Obwohl der Tabakkonsum in Deutschland deutlich abgenommen hat, erkranken weiterhin zahlreiche Menschen an einem Lungenkrebs.
Im St. Bernward Krankenhaus werden Patienten mit Lungenkrebs zusammen mit der Klinik für Pneumologie und der Klinik für Thoraxchirurgie. In unserem Onkologischen Zentrum versorgt. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Klinik für Thoraxchirurgie am St. Bernward Krankenhaus ist die Diagnostik und Therapie – operativ und medikamentös – von gut- und bösartigen Lungenerkrankungen, insbesondere des Bronchialkarzinoms. Je nach Art, Lage und Schweregrad der Krebserkrankung bieten wir unterschiedliche Operationsmethoden an. Ihr persönlicher Vorteil bei der Behandlung in unserem fachübergreifenden Lungenzentrum liegt nicht nur in der Spezialisierung und der großen Erfahrung, sondern auch in der engen Kooperation und Vernetzung mit allen an der Behandlung von Lungenkrebserkrankungen beteiligten Fachdisziplinen. Dazu gehören zum Beispiel die Pneumoonkologie, die Strahlentherapie oder die Hämatoonkologie. Gemeinsam entwickeln wir in unserem zertifizierten Onkologischen Zentrum und fachübergreifendem Lungenzentrum individuelle, optimal abgestimmte Therapieverfahren.
Bereits seit 2024 bieten wir die ambulante spezialfachärztliche Versorgung für Patienten mit Tumorerkrankungen an (ASV §116b): Damit erhalten Patienten eine umfassende qualitätsgesicherte ambulante Versorgung.
Der Brustkrebs = Mammakarzinom ist eine bösartige Krebserkrankung des Brustgewebes und die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Häufig sind Frauen nach der Menopause = Wechseljahre betroffen. Wird der Brustkrebs frühzeitig entdeckt, kann er häufig geheilt werden. Daher sollten Frauen jeden Alters die Brustkrebs-Symptome kennen, auf sie achten und alle Möglichkeiten der Früherkennung nutzen. Bei Frauen ab 50 Jahren übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Früherkennungsuntersuchungen. Auch Männer können – wenn auch deutlich seltener – an Brustkrebs erkranken.
Dennoch bedeutet nicht jede Veränderung im Brustgewebe eine Krebserkrankung. Verhärtungen, Schwellungen oder Knoten können auch harmlose Ursachen haben. Moderne Untersuchungsverfahren ermöglichen das frühzeitige Erkennen der Vorstufen – auch wenn sich aus diesen keinesfalls zwangsläufig Brustkrebs entwickeln muss. Ob und wie eine mögliche Behandlung erfolgt, hängt von der Art der Veränderung und dem persönlichen Brustkrebsrisiko der Betroffenen ab. Symptome wie z.B. Verhärtungen oder Knoten in den Brüsten oder den Achselhöhlen, Hautveränderungen – z.B. Rötungen, Entzündungen oder Orangenhaut –, schmerzhafter oder nicht schmerzhafter Juckreiz der Brust, Veränderungen der Farbe oder Form der Brustwarzen oder Absonderung von Flüssigkeiten sollten jedoch schnellstmöglich fachärztlich abgeklärt werden.
Brustkrebs wird nach Entstehungsort und Stadium der Erkrankung unterteilt. Am häufigsten ist das sogenannte duktale Mammakarzinom – es entsteht in den Milchgängen. Hat der Brustkrebs seinen Entstehungsort in den Milchdrüsen, handelt es sich um das – deutlich seltenere – lobuläre Mammakarzinom. Die vier Einteilungsstadien des Brustkrebses zeigen auf, wie weit fortgeschritten die Erkrankung ist. Die Einteilung erfolgt nach der Größe des Tumors = Abkürzung T, der Beteiligung von Lymphknoten = Abkürzung N und dem Vorhandensein von Fernmetastasen = Abkürzung M.
Es gibt zahlreiche unterschiedliche Formen von Brustkrebs. Die konkreten Merkmale werden mittels spezieller Untersuchungen diagnostiziert – sie sind entscheidend für die jeweilige Therapie. So wachsen z.B. manche Brustkrebsarten unter dem Einfluss des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen. Entsprechende Medikamente blockieren die Wirkung des Hormons und erlauben so eine sehr erfolgreiche Behandlung dieser Brustkrebsformen. Andere Brustkrebse weisen spezifische Angriffspunkte, z.B. auf molekularer Ebene, auf. Diese erlauben eine zielgerichtete Therapie oder Immuntherapie.
Brustkrebs entsteht durch die Veränderungen des Erbguts gewöhnlicher Körperzellen: Die Körperzellen entarten und verlieren dadurch ihre spezifische Struktur und Funktion. In der Folge vermehren sie sich unkontrolliert und führen zum Wachstum von Krebs. Zu den Risikofaktoren zählen u.a. erbliche Veranlagung, Übergewicht = Adipositas, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Diabetes mellitus Typ II = Zuckerkrankheit, schädlicher Genussmittelkonsum, eine Hormonersatztherapie nach dem 50. Lebensjahr und dichtes Brustgewebe, dh. wenig Fett- dafür mehr Drüsen- und Bindegewebe. Häufig treten Brustkrebserkrankungen bei Frauen in der Altersspanne zwischen 50 und 70 Jahren auf. Zudem gilt das Risiko an einem Mammakarzinom zu erkranken bei Kinderlosigkeit, Erstgeburten nach dem 32. Lebensjahr, frühzeitigem Einsetzen der ersten Regelblutung und der späte Beginn der Wechseljahre als geringfügig erhöht.
Das Therapiekonzept des Mammakarzinoms hängt von dessen Stadium zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, der Lage des Tumors und den Eigenschaften der Krebszellen ab. Dank der Früherkennungsuntersuchungen wird Brustkrebs häufig in einem Stadium mit guten Heilungsaussichten entdeckt. Für die Wahl der Therapieverfahren spielen aber auch Vorerkrankungen, das Alter und der allgemeine Gesundheitszustand eine Rolle.
In Frage kommen – neben einer Operation – Strahlentherapie, Chemotherapie, Hormonblockade- oder Immuntherapien
Wenn irgend möglich, ist die brusterhaltende Operation die Therapie der ersten Wahl. Sie wird häufig mit anderen Therapieverfahren – z.B. der Strahlentherapie, der Chemotherapie oder anderen zielgerichteten Therapien kombiniert. Unter Umständen ist es auch – für eine schonendere Operationsmöglichkeit – erforderlich, große Mammatumore mithilfe anderer Therapien vor der Operation zu verkleinern. Im Rahmen der Operation werden Lymphknoten im Achselbereich entfernt und auf den Befall mit Krebszellen untersucht.
Ist eine Operation nicht möglich, kann eine Strahlentherapie zur Zerstörung des Mammakarzinoms eingesetzt werden – in frühen Stadien kann diese auch eine Heilung erreichen. Nach einer brusterhaltenden Operation wird die Strahlentherapie eingesetzt, um Rückfälle durch unerkanntes restliches Krebsgewebe zu verhindern. In fortgeschrittenen Stadien kann die Strahlentherapie große Tumoren verkleinern und so eine Operation erst ermöglichen.
Die Chemotherapie bekämpft Krebszellen, die durch die Operation oder eine Bestrahlung nicht entfernt werden konnten. Die Chemotherapie wird als systemische Therapie eingesetzt, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Brustkrebs unerkannt gestreut hat oder bereits Metastasen = Tochtergeschwulste festgestellt wurden.
Ein erheblicher Anteil der Mammakarzinome wächst unter dem Einfluss des Geschlechtshormons Östrogen. Durch die Gabe hormonblockierender Medikamente kann die Wirkung des Östrogens auf den Brustkrebs blockiert und der Brustkrebs bekämpft werden. Diese sogenannte Hormonblockadertherapie kann auch in Kombination mit anderen Therapien zum Einsatz kommen.
Einige Brusttumore lassen durch die Gabe spezieller Medikamente zerstören bzw. am Wachstum hindern. Diese sogenannten zielgerichteten Therapien sind jedoch nur dann wirksam, wenn der Brustkrebs entsprechende Angriffspunkte aufweist, dh. auf sie reagiert. Ob eine solche Therapie in Betracht kommt, wird durch die Untersuchung von Gewebeproben festgestellt.
Das körpereigene Immunsystem erkennt und zerstört Krebszellen in der Regel, bevor sich ein Brustkrebs entwickelt. Einige Krebszellen täuschen oder blockieren jedoch das Immunsystem – sie werden nicht als Krebszellen erkannt und somit nicht zerstört. Spezielle Immuntherapien schalten die Abwehrmechanismen der Krebszellen aus, so dass das körpereigene Immunsystem das Mammakarzinom bekämpfen kann.
Im Anschluss an die medizinische Behandlung gehören regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen unbedingt zur Therapie des Mammakarzinoms. Eine medizinische Rehabilitation – kurz: Reha – hilft den Betroffenen meist dabei, wieder in den Alltag zu finden. Bei der Beantragung unterstützt unser Sozial- und Entlassmanagement gern.
All diese Therapien haben Nebenwirkungen und Risiken. Deshalb ist eine sorgfältige Anamnese und eingehende Diagnostik elementar wichtig, um die bestmögliche Auswahl und Kombination der Verfahren zu gewährleisten.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Der Dickdarm besteht aus mehreren Abschnitten: Das Zökum ist ein kurzes Stück Darmstück im rechten Unterbauch – mit einem kleinen Anhängsel, dem Wurmfortsatz oder Blinddarm = Appendix vermiformis. Das Kolon = Dickdarm besteht aus aufsteigenden, quer verlaufenden = Querkolon und absteigenden Darmschlingen und dem Sigmoid, das in den Mast- und Enddarm = Rektum übergeht. Der Darm ist – neben der Verdauung – wichtig für die Immunabwehr.
Der Dickdarmkrebs gehört zu den häufigsten Tumorerkrankungen. Meist handelt es sich dabei um Dickdarm- oder Mastdarmkrebs = Kolorektalkarzinom. Dünndarmkrebs kommt eher selten vor. Häufig hat der Tumor zum Zeitpunkt der Diagnosestellung bereits gestreut, d.h. Tochtergeschwüre = Metastasen gebildet.
Die linke Seite des Darms ist häufiger betroffen als die rechte. Die meisten Darmtumore entwickeln sich im absteigenden Teil des Kolons, im Sigmoid oder im Rektum. Sehr häufig entsteht Darm- und Mastdarmkrebs aus gutartigen Vorstufen – sogenannten Polypen = Aussackungen in der Darmschleimhaut. Bei den Polypen handelt es sich meist um Adenome, d.h. gutartige drüsige Wucherungen. Diese Adenome können im Laufe der Zeit entarten und gefährlich werden. Ihre frühzeitige Entdeckung und Entfernung – etwa im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung = Vorsorgekoloskopie beim Gastroenterologen – verhindert die Entstehung eines Großteils kolorektaler Karzinome.
Wird Darmkrebs diagnostiziert, sind Therapie und Heilungschancen von einigen Faktoren abhängig: Das Tumorstadium gibt an, wie tief der Tumor in die Darmwand eingedrungen ist, ob Lymphknoten befallen sind und ob Metastasen vorliegen. Nur wenige Darmtumoren werden im Stadium I entdeckt, da sie fast nie Symptome verursachen. Der überwiegende Teil der Darmtumore wird erst im Stadium II oder III entdeckt. In beiden Stadien hat der Krebs bereits alle Wandschichten des Darms befallen = Stadium II oder sogar auf benachbarte Lymphknoten ausgedehnt = Stadium III. Darmkrebs streut = metastasiert über das Blut vor allem in die Leber und die Lunge. Über die Lymphgefäße gelangen die Krebszellen vor allem aber auch in nahe gelegene Lymphknoten und befallen durch direkte Ausbreitung das Bauchfell.
Gemeinsam mit unserer Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, der Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie der Klinik für Urologie und der Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe behandeln wir in unserem zertifizierten Darmkrebszentrum Patienten mit Darm- und Darmkrebserkrankungen. Die Versorgung umfasst die Diagnostik, die Operation und die medikamentöse Therapie.
siehe auch: Erkrankungen an Dick-, Mast- & Enddarm
Zu den Gynäkologische Tumoren gehören unterschiedliche Tumorformen, die verschiedene Organe betreffen können: die Gebärmutter, der Gebärmutterhals, die Eierstöcke, die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane. Die meisten Tumore treten im höheren Lebensalter auf – einige, wie z.B. der Gebärmutterhalskrebs – bereits in jüngeren Jahren.
Der Eierstockkrebs = Ovarialkarzinom ist ein sehr aggressiver und häufig vorkommender Tumor. Er tritt häufig bei Frauen jenseits der 50 Jahre auf – kann aber auch jüngere Frauen betreffen. Es gibt mehrere Formen von Eierstockkrebs – abhängig davon, welcher Zelltyp den Krebs hervorruft. Risikofaktoren für eine Erkrankung sind z.B. erbliche Veranlagung, Adipositas = Fettleibigkeit und späte Geburten. Häufige Schwangerschaften und die Verhütung mit der Pille scheinen das Risiko zu senken. Eierstockkrebs wird meist erst in einem späten Krankheitsstadium diagnostiziert. Unbestimmte Bauch- oder Beckenschmerzen, Druckgefühl, ein aufgeblähter Bauch durch Flüssigkeitsansammlung oder unklare Verdauungsbeschwerden können frühe Anzeichen für eine Erkrankung sein. Da der Eierstockkrebs häufig im Frühstadium unerkannt bleibt, stehen die Heilungschancen eher ungünstig. Nach Möglichkeit wird der Tumor nach seiner Entdeckung operativ entfernt. Der Operation folgt in der Regel eine Chemotherapie.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Die Schilddrüse befindet sich unterhalb des Kehlkopfes vor der Luftröhre. Sie gehört zu den hormonproduzierenden Organen und spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation vieler Körperfunktionen. Zu den hormonproduzierenden Organen gehören die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse, die Nebennieren und die Bauchspeicheldrüse = Pankreas. Erkrankungen der Schilddrüse können sich durch eine diffuse Vergrößerung, eine knotige Umstrukturierung oder durch eine Funktionsstörung des Organs zeigen. Dementsprechend vielseitig sind die Beschwerden.
Die Nebenschilddrüsen sind vier ungefähr erbsengroße Drüsen, die an der Rückseite der Schilddrüse liegen und das sogenannte Parathormon produzieren. Dieses Hormon reguliert den Calciumstoffwechsel.
Die beiden Nebennieren befinden sich oberhalb der rechten und linken Niere im hinteren Bauchraum. Die etwa zwei bis drei cm großen Nebennieren produzieren verschiedene Hormone – beispielsweise Adrenalin, Cortisol und Aldosteron.
Die Milz ist ein ca. faustgroßes lymphatisches Organ und liegt unter dem Rippenbogen im linken Oberbauch. Sie grenzt an den Magen, das Zwerchfell und an die linke Niere. Eine der Hauptaufgaben der Milz ist das Herausfiltern und der Abbau überalterter roter Blutzellen = Erythrozyten. Im Gegensatz zu den Lymphknoten ist die Milz nicht in das Lymphsystem, sondern in den Blutkreislauf eingebunden. Eine funktionierende Milz ist wichtig, aber – vor allem bei Erwachsenen – nicht zwingend lebensnotwendig. Muss sie – z.B. aufgrund eines Unfalls – operativ entfernt werden, übernehmen andere Körperorgane zumindest teilweise ihre Aufgaben. Nach einer solchen Milzentfernung = Splenektomie sind die Betroffenen allerdings häufig anfälliger für Infekte und weisen bei Infektionen mit bestimmten Bakterien ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe auf.
Erkranken die Schilddrüse oder die Nebenschilddrüse, oder bilden sich Tumore in den Nebennieren, ist eine Operation oft die Therapie der Wahl. Sie gibt den Patienten Sicherheit und kann eine dauerhafte körperliche Beeinträchtigung vermeiden. Selbstverständlich besprechen wir diesen Schritt mit unseren Patienten nach einer ausführlichen und differenzierten Diagnostik. Die Endokrine Chirurgie ist die Chirurgie der hormonproduzierenden Organe.
Die Überwachung des Stimmbandnervs während der Schilddrüsenoperation ist bei uns selbstverständlich. Ausgedehnte Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse können wir dank spezieller Verfahren und der notwendigen fachübergreifenden Überwachung auch älteren Betroffenen sicher anbieten – hier arbeiten wir in unserem Pankreaszentrum eng mit anderen Fachabteilungen, z.B. mit der Medizinischen Klinik III, der Gastroenterologie, zusammen. Dies gilt sowohl für chronische Entzündungen als auch für Tumorerkrankungen.
Unsere Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam in unserem zertifizierten Pankreaszentrum sowohl gut- als auch bösartige Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse umfassend und qualitätsgesichert.
Siehe auch: Pankreaskarzinom, endokrine Erkrankungen
Zu den Gynäkologische Tumoren gehören verschiedene Tumorformen, die unterschiedliche Organe betreffen können: dazu gehören die Gebärmutter, der Gebärmutterhals, die Eierstöcke, die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane. Die meisten Tumoren treten im höheren Lebensalter auf – einige, wie z.B. der Gebärmutterhalskrebs – bereits in jüngeren Jahren.
Durch Geschlechtsverkehr können sogenannte Humane Papillomviren – kurz HPV – übertragen werden, die Gebärmutterhalskrebs = Zervixkarzinom auslösen können. Der Gebärmutterhals ist die Verbindung zwischen Scheide und Gebärmutter. Neben einer HPV-Infektion stellen u.a. ein früher Beginn sexueller Aktivität, eine hohe Anzahl wechselnder Sexualpartner, viele Schwangerschaften – vor allem in jungen Jahren – und eine langjährige Einnahme der Pille Risikofaktoren dar, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Durch eine Impfung gegen bestimmte krebserregende Typen der HP-Viren sinkt das Erkrankungsrisiko deutlich. Auch der Zellabstrich vom Gebärmutterhals bei der jährlichen, kostenlosen Untersuchung zur Krebsfrüherkennung gibt Aufschluss über mögliche Zellveränderungen. Diese Veränderungen können behandelt werden, bevor der Krebs entsteht. Unterleibs- oder Beckenschmerzen, ungewöhnliche Blutungen, übelriechender Ausfluss oder Schmerzen bei Wasserlassen oder Stuhlgang können auf Gebärmutterhalskrebs hinweisen. Behandelt wird der Gebärmutterhalskrebs in der Regel durch Bestrahlung von außen und Brachytherapie oder medikamentöse Therapie – z.B. Chemotherapie.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Zu den Gynäkologische Tumoren gehören unterschiedliche Tumorformen, die verschiedene Organe betreffen können: die Gebärmutter, den Gebärmutterhals, die Eierstöcke, die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane.
Beim Gebärmutterschleimhautkrebs = Endometriumkarzinom bilden sich Tumoren in der Schleimhaut der Gebärmutter. Unterschieden werden zwei Typen von Tumoren: das häufigere östrogenabhängige Typ 1 Karzinom und das östrogenunabhängige Typ 2 Karzinom. Beim Typ 1 Karzinom sind die Tumorzellen den gesunden Zellen noch recht ähnlich und daher wenig aggressiv. Beim Typ 2 Karzinom sind die Tumorzellen entartet und somit aggressiver. Typ 2 tritt häufiger bei älteren Patientinnen auf. Ursächlich für den Gebärmutterschleimhautkrebs sind z.B. Bluthochdruck, Fettleibigkeit = Adipositas, eine frühe Menstruation und eine späte Menopause. Da beim Gebärmutterschleimhautkrebs kaum Symptome auftreten, wird er häufig erst in einem späteren Krankheitsstadium erkannt. Mögliche, gegebenenfalls durch den Gynäkologen = Frauenarzt abzuklärende Symptome sind z.B. Ausflüsse oder Blutungen vor der Menopause, die nicht mit der Periode zusammenhängen, ebenso jegliche Blutungen nach der Menopause. Die Behandlung von Gebärmutterschleimhautkrebs hängt vom Krankheitsstadium ab. Häufig ist eine Operation die Therapie der ersten Wahl, der meist eine Bestrahlung folgt. Ist eine Operation nicht zielführend oder möglich, erfolgt eine alleinige Bestrahlung – ggf. kombiniert mit einer Chemotherapie.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Der Begriff Gerinnungsstörung = Hämostaseologie ist ein Oberbegriff für eine Gruppe von Erkrankungen, bei denen das Blut nicht im richtigen Maß gerinnt. Menschen mit Gerinnungsstörungen leiden deshalb unter schweren Nachblutungen z.B. nach Verletzungen, während der Menstruation, bei Unfällen oder bei Operationen. In dieses Fachgebiet gehören daher Blutungserkrankungen ebenso wie Thrombosen und Embolien.
Bei einer Thrombose verengt oder verschließt ein Blutgerinnsel = Thrombus ein Blutgefäß. Häufig entstehen Thrombosen in den Venen – meist in den Beinen. Die Venen transportieren das sauerstoffarme Blut aus dem Körper zurück zum Herzen. Bei einer arteriellen Thrombose verengt oder verschließt ein Blutgerinnsel eine Arterie. Die Arterien transportieren sauerstoffreiches Blut aus dem Herzen in den Körper. Arterielle Thrombosen sind häufig die Ursache für Herzinfarkte oder Schlaganfälle.
Damit Folgeschäden möglichst ausbleiben, sollten Thrombosen schnell behandelt werden. Während die Therapie bei massiven Thrombosen stationär erfolgt, können leichte Thrombosen in der Regel ambulant behandelt werden. Erstes Ziel ist es, das Blutgerinnsel aufzulösen und sein Wachstum zu unterbinden. Therapie der Wahl sind gerinnungshemmende Medikamente, die den Blutfluss wiederherstellen und auch der Vorbeugung von Embolien (s.u.) dienen. Neben der medikamentösen Therapie unterstützen Kompressionsstrümpfe, Krankengymnastik und physikalische Maßnahmen dabei, Symptome zu lindern, Schwellungen abzubauen und den Blutfluss in den Venen zu verbessern.
Der Verlauf und die Prognose einer Thrombose hängen davon ab, wo sie stattgefunden hat, wie groß der Thrombus war und wie schnell er aufgelöst oder entfernt werden konnte. Mögliche Folgen einer Thrombose sind – neben erneuten Verschlüssen – Embolien und das sogenannte postthrombotische Syndrom. Das postthrombotische Syndrom entsteht häufig als Folge einer Thrombose in den tiefergelegenen Venen. Typische Beschwerden sind Verfärbungen der Haut, juckende Hautausschläge, Schwellungen und Schmerzen bis hin zu offenen Geschwüren.
Embolien werden durch abgelöste Teile des Thrombus = Embolus verursacht. Der Embolus wird mit dem Blutstrom in andere Körperregionen transportiert und verursacht dort ähnliche Symptome wie eine Thrombose. Manchmal – aber eher selten – verschließt der Embolus die Lungengefäße und es kommt zu einer Lungenembolie. Da sich das Blut dann in der Herzregion staut, können die Überlastung des Herzens und ein lebensbedrohliches Herzversagen die Folge sein.
Als Risikofaktoren für Thrombosen gelten Thrombose-Vorerkrankungen, Bluthochdruck, Alter, Übergewicht, Rauchen, Diabetes mellitus, Bewegungsmangel, Venenkrankheiten – z.B. Krampfadern – Fettstoffwechselstörungen, die Einnahme von Östrogenen oder genetische Blutgerinnungsstörungen.
Unsere Klinik für Gefäßchirurgie, Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin – Medizinische Klinik I führen sämtliche medikamentösen, offenchirurgischen und interventionellen Eingriffe zur Therapie venöser und thromboembolischer Erkrankungen durch. Dazu gehören u.a. Krampfadern, Varikose, Varikosis, Venenerweiterung, Thrombose, TVT, Thrombosen, Beinvenenthrombosen, Lungenembolien, chronisch venöse Insuffizienz und Venenschwäche. Alle hierfür wichtigen Laboruntersuchungen erfolgen in unserem Zentrallabor.
Bei sehr schweren Thrombose- oder Embolieverläufen kann ggf. auch eine kurzzeitige komplette Auflösung aller Blutgerinnung = Lysetherapie oder die Absaugung der Blutgerinnsel = Thrombektomie durchgeführt werden. Für komplexere Untersuchungen besteht eine enge Kooperation mit der Klinik für Hämostaseologie der Medizinischen Hochschule Hannover.
Siehe auch: Venöse Erkrankungen, Krampfadern
Zu den Gynäkologische Tumoren gehören unterschiedliche Tumorformen, die verschieden Organe betreffen können: die Gebärmutter, den Gebärmutterhals, die Eierstöcke, die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane. Die meisten Tumoren treten im höheren Lebensalter auf – einige, wie z.B. der Gebärmutterhalskrebs – bereits in jüngeren Jahren.
Beim Gebärmutterschleimhautkrebs = Endometriumkarzinom bilden sich Tumoren in der Schleimhaut der Gebärmutter. Unterschieden werden zwei Typen von Tumoren: das häufigere östrogenabhängige Typ 1 Karzinom und das östrogenunabhängige Typ 2 Karzinom. Beim Typ 1 Karzinom sind die Tumorzellen den gesunden Zellen noch recht ähnlich und daher wenig aggressiv. Beim Typ 2 Karzinom sind die Tumorzellen entartet und somit aggressiver. Typ 2 tritt häufiger bei älteren Patientinnen auf. Ursächlich für den Gebärmutterschleimhautkrebs sind z.B. Bluthochdruck, Fettleibigkeit = Adipositas, eine frühe Menstruation und eine späte Menopause. Da beim Gebärmutterschleimhautkrebs kaum Symptome auftreten, wird er häufig erst in einem späteren Krankheitsstadium erkannt. Mögliche, gegebenenfalls durch den Gynäkologen = Frauenarzt abzuklärende Symptome sind z.B. Ausflüsse oder Blutungen vor der Menopause, die nicht mit der Periode zusammenhängen, ebenso jegliche Blutungen nach der Menopause. Die Behandlung von Gebärmutterschleimhautkrebs hängt vom Krankheitsstadium ab. Häufig ist eine Operation die Therapie der ersten Wahl, der meist eine Bestrahlung folgt. Ist eine Operation nicht zielführend oder möglich, wird eine alleinige Bestrahlung – ggf. kombiniert mit einer Chemotherapie – durchgeführt.
Durch Geschlechtsverkehr können sogenannte Humane Papillomviren – kurz HPV – übertragen werden, die Gebärmutterhalskrebs = Zervixkarzinom auslösen können. Der Gebärmutterhals ist die Verbindung zwischen Scheide und Gebärmutter. Neben einer HPV-Infektion stellen u.a. ein früher Beginn sexueller Aktivität, eine hohe Anzahl wechselnder Sexualpartner, viele Schwangerschaften – vor allem in jungen Jahren – und eine langjährige Einnahme der Pille Risikofaktoren dar, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Durch eine Impfung gegen bestimmte krebserregende Typen der HP-Viren sinkt das Erkrankungsrisiko deutlich. Auch der Zellabstrich vom Gebärmutterhals bei der jährlichen, kostenlosen Untersuchung zur Krebsfrüherkennung gibt Aufschluss über mögliche Zellveränderungen. Diese Veränderungen können behandelt werden, bevor der Krebs entsteht. Unterleibs- oder Beckenschmerzen, ungewöhnliche Blutungen, übelriechender Ausfluss oder Schmerzen bei Wasserlassen oder Stuhlgang können auf Gebärmutterhalskrebs hinweisen. Behandelt wird der Gebärmutterhalskrebs in der Regel durch Bestrahlung von außen und Brachytherapie oder medikamentöse Therapie – z.B. Chemotherapie.
Der Gebärmutterkrebs = Uteruskarzinom, Korpuskarzinom ist ein bösartiger Tumor der meist im oberen Teil des Uterus, dem Gebärmutterkörper = Korpus entsteht. Er entwickelt sich allerdings in der Regel nicht aus der Muskelschicht, sondern aus der Schleimhaut der Gebärmutter und verursacht den Gebärmutterschleimhautkrebs = Endometriumkarzinom (s.o.).
Der Eierstockkrebs = Ovarialkarzinom ist ein sehr aggressiver und häufig vorkommender Tumor. Er tritt häufig bei Frauen jenseits der 50 Jahre auf – kann aber auch jüngere Frauen betreffen. Es gibt mehrere Formen von Eierstockkrebs – abhängig davon, welcher Zelltyp den Krebs hervorruft. Risikofaktoren für eine Erkrankung sind z.B. erbliche Veranlagung, Adipositas = Fettleibigkeit und späte Geburten. Häufige Schwangerschaften und die Verhütung mit der Pille scheinen das Risiko zu senken. Eierstockkrebs wird meist erst in einem späten Krankheitsstadium diagnostiziert. Unbestimmte Bauch- oder Beckenschmerzen, Druckgefühl, ein aufgeblähter Bauch durch Flüssigkeitsansammlung oder unklare Verdauungsbeschwerden können frühe Anzeichen für eine Erkrankung sein. Da der Eierstockkrebs häufig im Frühstadium unerkannt bleibt, stehen die Heilungschancen eher ungünstig. Nach Möglichkeit wird der Tumor nach seiner Entdeckung operativ entfernt. Der Operation folgt in der Regel eine Chemotherapie.
Das Vaginalkarzinom = Scheidenkrebs gehört zu den eher selteneren Krebserkrankungen. Meist wird er durch die Ausbreitung von Tumoren aus benachbarten Organen in die Scheide verursacht. – z.B. aus der Harnröhre oder aus dem Gebärmutterhals – in die Scheide ausbreiten. Vorwiegend Frauen zwischen 60 und 65 Jahren sind von Scheidenkrebs betroffen. Zu den Risikofaktoren für die Entstehung von Scheidenkrebs gehören z.B. Virusinfektionen mit Viren oder erhöhte Strahlenbelastung im Beckenbereich. Die Diagnose Scheidenkrebs ist häufig ein Zufallsbefund einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung. Symptome treten meist erst im fortgeschrittenen Stadium auf – dazu gehören z.B.Unterleibsschmerzen, zäher, blutiger Ausfluss, Scheidenblutungen und Organstörungen von Harnblase oder Darm. Scheidenkrebs lässt sich meist erfolgreich mit einer Kombination aus Bestrahlung und Operation behandeln.
Der Vulvakrebs = Vulvakarzinom ist eine Krebserkrankung der äußeren Geschlechtsorgane. Er betrifft meist die Schamregion im Hautbereich – meist die Schamlippen – älterer Frauen. Bei jüngeren Frauen ist der Vulvakrebs häufig auf eine Infektion mit Humanen Papilloma Viren (HPV) zurückzuführen. Anzeichen für eine Erkrankung können z.B. Schmerzen, Wundsein, Jucken und / oder Brennen in den beschriebenen Hautregionen sein. Die Diagnose Vulvakarzinom ist häufig ein Zufallsbefund einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung. Bei Tumoren, die nicht durch eine Operation entfernt werden können oder bereits Lymphknoten befallen haben, kommt eine Strahlentherapie zum Einsatz und ggf. mit einer Chemotherapie kombiniert.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Mit Hirntumore sind nicht nur Tumore im Gehirn gemeint. Zwar entstehen Hirntumore am häufigsten im Gehirn und in den Gehirnhäuten = Gehirntumore, dennoch umfasst der Begriff alle Zellwucherungen des zentralen Nervensystems – kurz ZNS. Hierzu gehören Gehirn & Gehirnhäute, Rückenmark & Rückenmarkhäute und die Hirnnerven, die vom Gehirn ausgehen und andere Körperregionen versorgen.
Zu unterscheiden sind gutartige und bösartige Hirntumore. Bösartige Tumore = Krebs wachsen schneller als gutartige und können Metastasen = Tochtergeschwüre bilden. Die Weltgesundheitsorganisation – kurz WHO – klassifiziert Hirntumore nach ihrer Gut- oder Bösartigkeit in die Grade I-IV: langsam wachsender gutartiger Hirntumor mit langsamem Wachstum, teilweise gutartiger Hirntumor, bösartiger Hirntumor und sehr bösartiger Hirntumor mit schnellem Wachstum. Zusätzlich unterscheidet man sogenannte primäre Tumore und sekundäre Tumore im zentralen Nervensystem. Die primären Hirntumore entstehen aus Zellen des zentralen Nervensystems. Dazu gehören beispielsweise die Gliome, Meningeome, Medullablastome und Neurinome. Wenn sich im Gehirn infolge einer Krebserkrankung in anderen Körperregionen ein Tumor bildet, spricht man von sekundären Hirntumore oder Hirnmetastasen. Im Vergleich zu anderen Tumorkrankheiten sind primäre Hirntumore eher selten. Als Risikofaktoren gelten z.B. familiäre Veranlagung, bestimmte Erbkrankheiten und erfolgte Strahlentherapien im Kopfbereich.
Die Heilungschancen = Prognose bei gutartigen Hirntumoren, die sich durch eine Operation oder eine Strahlentherapie ohne Folgeschäden komplett entfernen lassen, sind in der Regel gut – ebenso, wenn der Tumor gut auf eine Chemo- oder Immuntherapie oder zielgerichtete Therapien anspricht. Bei fortgeschrittenen, bösartigen Gehirntumoren, bei denen die möglichen Therapien nicht (mehr) wirken, sind die Heilungschancen schlecht. Dazwischen gibt es eine große Bandbreite verschiedener Möglichkeiten. Generell gilt: Je höher der Tumorgrad, desto schlechter ist die Prognose. Als spezifische Symptome = Anzeichen für Hirntumore gelten z.B. neu – vor allem nachts im Liegen – auftretende, zunehmend heftige Kopfschmerzen, epileptische Anfälle ohne bekanntes Anfallsleiden, Übelkeit und Erbrechen am Morgen – nüchtern und ohne Magen-Darm-Erkrankung – oder eine neu auftretende Ungeschicklichkeit ohne erkennbare Ursache.
Die Wahl der Therapie bei Hirntumoren ist – neben Alter und Allgemeinzustand des Betroffenen – abhängig davon, wo der Tumor im Gehirn sitzt, von seiner Größe, dem Tumorgrad (s.o.), der Tumorart und seinen genetischen Eigenschaften. Hirnmetastasen werden mit Medikamenten behandelt, die gegen den Ursprungskrebs und im Gehirn wirken.
Im Rahmen einer onkologisch-neurologischen Rehabilitation, die sich in der Regel der akuten Therapie anschließt, werden vor allem die Folgen der Tumorerkrankung und -therapie behandelt – ggf. auch der Tumor selbst, sofern er nicht vollständig entfernt werden konnte. Häufig leiden die Betroffenen unter neurologischen Ausfallerscheinungen wie z.B. Lähmungserscheinungen, Sprach- & Sprechstörungen, Gedächtnis-, Aufmerksamkeits-, Konzentrations- oder Orientierungsbeeinträchtigungen.
Da in diesem Gebiet sowohl die Krankheitsbilder als auch die Verläufe sehr unterschiedlich sind, ist für die Nachsorge und Rehabilitation grundsätzlich ein individuelles Vorgehen erforderlich.
In enger Kooperation mit der Klinik für Neurologie & klinische Neurophysiologie im St. Bernward Krankenhaus und der Neurochirurgischen Klinik in Seesen diagnostizieren und operieren wir Patienten mit Hirntumoren. Die medikamentöse Behandlung und die Strahlentherapie erfolgen in unserem Onkologischen Zentrum.
Immunologische Erkrankungen sind angeborene oder erworbene Abwehrerkrankungen des körpereigenen Abwehr- bzw. Immunsystems. Bei manchen immunologischen Erkrankungen ist für die Diagnostik und Therapie eine stationäre Behandlung erforderlich. Das ist häufig bei Patienten mit Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis erforderlich. Die Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises definiert die Weltgesundheitsorganisation – kurz WHO – als Erkrankungen des Bindegewebes und schmerzhafte Störungen des Bewegungsapparats, die zur Ausbildung chronischer Symptome führen können. Chronisch bedeutet: sich langsam entwickelnd, schleichend, von langer Dauer.
In unserer Klinik Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II diagnostizieren und behandeln wir Patienten mit immunologischen Erkrankungen. Alle hierfür wichtigen Laboruntersuchungen erfolgen in unserem Zentrallabor. Wir pflegen eine enge Kooperation mit der rheumatologischen Schwerpunktpraxis in Hildesheim.
Leukämie = Blutkrebs ist eine Gruppe von Krebserkrankungen des blutbildenden Systems. Bei den Leukämien werden zu viele Vorläuferzellen der Leukozyten = weiße Blutkörperchen gebildet. Leukämie ist genaugenommen der Oberbegriff für verschiedene Erkrankungen, bei denen die Blutbildung im Knochenmark gestört ist. Durch die Fehlfunktion bestimmter Kontrollgene gelangen unvollständig entwickelte weiße Blutkörperchen ins Blut. Diese sind nicht funktionsfähig – vermehren sich aber meist sehr schnell und unkontrolliert und stören die normale Blutbildung im Knochenmark. Die unreifen weißen Blutkörperchen verteilen sich im Körper und können sich in Organen wie Milz, Leber, Mandeln, Lymphknoten und anderem Körpergewebe ansiedeln. Leukämien entstehen aus Blutstamm- und Vorläuferzellen. Bei den akuten Verlaufsformen tritt die Erkrankung meist plötzlich und mit Beschwerden wie Schwäche, Blutungen und Infektanfälligkeit auf. Die chronischen Formen hingegen entwickeln sich langsam über Monate oder Jahre hinweg und beginnen schleichend. Insbesondere bei den akuten Leukämien gibt es zahlreiche Unterformen, die jeweils unterschiedlich therapiert werden und deren Heilungschancen sich unterscheiden.
Im Wesentlichen werden vier Formen von Leukämie unterschieden, die jeweils unterschiedlich behandelt werden:
Bei der akuten lymphatischen Leukämie – kurz ALL – entstehen aus den Vorläuferzellen der Lymphozyten = weiße Blutkörperchen bösartige Krebszellen. Die ALL tritt am häufigsten im Kindesalter auf. Bei Erwachsenen steigt das Erkrankungsrisiko ab dem fünfzigsten Lebensjahr bzw. dem achtzigsten Lebensjahr an – Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen.
Die chronische lymphatische Leukämie – kurz CLL – ist durch eine unkontrollierte Vermehrung von nicht funktionstüchtigen Lymphozyten in Knochenmark und Blut gekennzeichnet. Im Verlauf der Erkrankung kommt es zu einer meist starken Vermehrung dieser entarteten Zellen in Blut, Knochenmark, Lymphknoten, Milz und anderen Organen. In der Folge kommt es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Verdrängung gesunder Organe und deren Funktionen. Die chronische lymphatische Leukämie ist die häufigste Leukämieerkrankung des Erwachsenenalters. Das Erkrankungsrisiko nimmt mit steigendem Lebensalter zu. Die Ursache der CLL ist bis dato ungeklärt.
Bei der akuten myeloischen Leukämie – kurz AML – treten Mutationen in den Vorläuferzellen der Granulozyten, Erythrozyten = rote Blutzellen und Thrombozyten = Blutplättchen auf. Durch die Veränderungen des Erbmaterials vermehren sich die veränderten Zellen ungebremst, ohne sich zu funktionstüchtigen Blutkörperchen zu entwickeln. Sie breiten sich schnell im Knochenmark aus und verhindern die Bildung gesunder Blutkörperchen. Die Erkrankungswahrscheinlichkeit nimmt mit steigendem Lebensalter zu – ihre Ursache ist bis dato ungeklärt
Die chronische myeloische Leukämie – kurz CML – ist eine besondere Blutkrebform. Bei dieser Erkrankung verändern sich die Vorläuferzellen der weißen Blutkörperchen. Als Therapie der ersten Wahl gelten sogenannte Tyrosinkinase-Hemmer, die speziell für die Behandlung der CML entwickelt wurden. Das Medikament hindert die falsch programmierten weißen Blutkörperchen daran, sich weiterzuvermehren. Als Folge normalisiert sich die Blutbildung der Betroffenen. Dadurch wurde aus einer zuvor tödlichen eine chronische Erkrankung. Die Ursache für die CML ist noch unbekannt. Als gesichert gilt allerdings, dass es sich um einen Fehler im Bauplan der weißen Blutkörperchen handelt. CML tritt bei Männern häufiger auf als bei Frauen. Meist tritt die Erkrankung zwischen dem 45. und 60. Lebensjahr auf – grundsätzlich ist ihr Auftreten jedoch in jedem Alter möglich – Kinder sind jedoch nur selten betroffen.
In unserem zertifizierten Zentrum für Hämatologische Neoplasien werden Patienten mit akuten Leukämien qualitätsgesichert ambulant und stationär versorgt. Für die allogenen Stammzelltransplantation gibt es eine enge Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Hannover sowie mit der Universitätsklinik Göttingen. Im MVZ werden Patienten mit chronischen Leukämien betreut.
Unter dem Begriff Maligne Lymphome = Lymphdrüsenkrebs wird eine Gruppe von bösartigen Erkrankungen zusammengefasst – bestehend aus mindestens 30 Unterarten. Bei diesen Erkrankungen kommt es häufig zu einer schnellen, unkontrollierten Vermehrung von Zellen des lymphatischen Systems. Das lymphatische System dient der Abwehr von Krankheitserregern und befindet sich hauptsächlich in den Lymphknoten – aber auch in der Milz, den Mandeln, im Knochenmark und in einigen weiteren Organen. Typische Symptome dieser Erkrankung sind daher die Schwellung eines oder mehrerer Lymphknoten, aber auch Fieber ohne weitere Erkältungssymptome, starkes nächtliches Schwitzen, wenig Appetit, unerklärlicher Gewichtsverlust, Müdigkeit und Erschöpfung.
Die wichtigste Unterscheidung ist die zwischen niedrig malignen Lymphomen, die sich langsam entwickeln und hochmalignen Lymphomen, die ohne entsprechende Therapie schnell wachsen. Hier beschreiben wir die wichtigsten Gruppen von Lymphomen – die sich allerdings in Behandlung und Prognose teilweise erheblich unterscheiden.
Morbus Hodgkin ist eine niedrig-maligne = wenig bösartige lymphatische Erkrankung. Morbus Hodgkin ist selbst in fortgeschrittenen Stadien meist gut heilbar. Die Therapie richtet sich nach dem Stadium der Erkrankung und sorgfältig bestimmten Risikofaktoren. Häufigste Therapie ist eine Chemotherapie und eine ihr folgende Nachbestrahlung. Intensität und Dauer richten sich nach dem Stadium der Erkrankung. Die prinzipiell guten Behandlungsergebnisse werden allerdings durch die relativ häufigen Spätkomplikationen der Behandlung etwas relativiert: Einige Patienten entwickeln nach einigen Jahren andere Tumore, die durch die Chemo- und Strahlentherapie verursacht werden.
Die Therapie der niedrig-malignen Lymphome unterscheidet sich deutlich von der anderer Lymphome. Häufig benötigen Patienten lange Jahre überhaupt keine Therapie. Erkrankungen im fortgeschrittenem Stadium können in der Regel nicht geheilt, sondern nur zurückgedrängt werden. Eine Chemotherapie – oft in Kombination mit einer Antikörpertherapie – kommt erst zum Einsatz, wenn Symptome der Erkrankung spürbar werden, z.B. wenn Lymphknoten auf andere Organe drücken oder eine sogenannte B-Symptomatik auftritt. Allerdings kommt es in den meisten Fällen – meist nach einigen Jahren – zu einem Rückfall. Deshalb gelten niedrig-maligne Lymphome als unheilbar. Dennoch leben viele Patienten mit diesem Lymphom beschwerdefrei.
Bei hochmalignen Non-Hodgkin-Lymphomen wird versucht, durch eine schnelle, intensive Therapie einen anhaltenden Stillstand = Remission und möglichst eine Heilung zu erzielen. Häufigste Therapie ist eine Chemotherapie – seit einigen Jahren wird diese mit dem Antikörper Rituximab kombiniert. In manchen Fällen ist auch eine örtliche Nachbestrahlung sinnvoll – zum Beispiel, wenn ein Lymphknoten anfänglich besonders angeschwollen war oder andere Organe betroffen waren.
Der Lymphdrüsenkrebs ist eine häufige Erkrankung und kann in jeder Altersgruppe auftreten. In unserem zertifizierten Hämatologischen Zentrum werden Patienten mit Lymphdrüsenkrebs qualitätsgesichert ambulant und stationär versorgt. Hierzu gehört neben der umfassenden Diagnostik die zielgerichtete Therapie.
Die beiden Nebennieren befinden sich oberhalb der rechten und linken Niere im hinteren Bauchraum. Die etwa zwei bis drei Zentimeter großen Nebennieren produzieren verschiedene Hormone – beispielsweise Adrenalin, Cortisol und Aldosteron.
Die Milz ist ein ca. faustgroßes lymphatisches Organ und liegt unter dem Rippenbogen im linken Oberbauch. Sie grenzt an den Magen, das Zwerchfell und an die linke Niere. Eine der Hauptaufgaben der Milz ist das Herausfiltern und der Abbau überalterter roter Blutzellen = Erythrozyten. Im Gegensatz zu den Lymphknoten ist die Milz nicht in das Lymphsystem, sondern in den Blutkreislauf eingebunden. Eine funktionierende Milz ist wichtig, aber – vor allem bei Erwachsenen – nicht zwingend lebensnotwendig. Muss sie – z.B. aufgrund eines Unfalls – operativ entfernt werden, übernehmen andere Körperorgane zumindest teilweise ihre Aufgaben. Nach einer solchen Milzentfernung = Splenektomie sind die Betroffenen allerdings häufig anfälliger für Infekte und weisen bei Infektionen mit bestimmten Bakterien ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe auf.
Bilden sich Tumore in den Nebennieren, ist eine Operation oft die Therapie der Wahl. Sie gibt den Patienten Sicherheit und kann eine dauerhafte körperliche Beeinträchtigung vermeiden. Selbstverständlich besprechen wir diesen Schritt mit unseren Patienten nach einer ausführlichen und differenzierten Diagnostik. Die Endokrine Chirurgie ist die Chirurgie der hormonproduzierenden Organe.
Unsere Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie, die Klinik für Urologie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln sowohl gut- als auch bösartige Erkrankungen von Milz und Nebennieren umfassend und qualitätsgesichert.
Der Nierenkrebs ist eine eher seltene Krebserkrankung, die meist als Zufallsbefund im Rahmen anderer Untersuchungen – z.B. CT oder Ultraschall – auffällt. Meist ist mit dem Begriff Nierenkrebs das Nierenzellkarzinom gemeint. Dieser Krebs bildet häufig Metastasen = Tochtergeschwüre – z.B. in der Lunge, den Knochen, Lunge oder im Gehirn.
Solange sich noch keine Metastasen gebildet haben, ist eine Operation des Tumors die Therapie der Wahl. Meist kann die Niere erhalten und nur der Tumor entfernt werden. Diese Operationen können in den meisten Fällen minimalinvasiv mit dem Da-Vinci-Xi-Operationssystem erfolgen. Dadurch werden Komplikationen wie Blutungen und Wundheilungsstörungen minimiert und der Krankenhausaufenthalt beträgt in der Regel nur wenige Tage.
Symptome wie z.B. Blut im Urin, wiederholte Harnblasenentzündungen, Flankenschmerzen, tastbare Schwellung oder Geschwulst in der Nierengegend, unklares Fieber, Müdigkeit, Appetitlosigkeit und Seiten- und Rückenschmerzen können auf einen Tumor hindeuten – sind bei Ihnen eine oder mehrere dieser Beschwerden vorhanden, sollten Sie sie schnellstmöglich fachärztlich abklären lassen.
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Klinik für Urologie im St. Bernward Krankenhaus ist die Behandlung von Patienten mit Nierenkrebs. Hierfür steht uns vor Ort ein hauseigener Da-Vinci Xi OP-Roboter zur Verfügung. Alle Patienten werden in Tumorkonferenzen vorgestellt und durch unser Uroonkologisches Zentrum betreut. Eine der Kernkompetenzen unserer Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II ist zudem die medikamentöse Behandlung von Patienten mit Nierenkrebs. Darüber hinaus werden sie im Rahmen unseres zertifizierten Onkologischen Zentrums betreut.
Trotz aller Fortschritte in der Onkologie lassen sich nicht alle Patienten heilen. Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen versorgen wir auf unserer Palliativstation. Darüber hinaus besteht eine enge Anbindung an die spezialärztliche palliative ambulante Versorgung und Hospize.
Unsere Palliativstation ist ein positiver Ort – ein Ort, der Mut macht, der Kraft gibt und auffängt, der die Menschen einfühlsam von ganzem Herzen annimmt, wie sie sind. Er verbindet Lebensqualität mit den Möglichkeiten der modernen Medizin für Menschen, die unheilbar erkrankt sind. Daher konzentriert sich unsere palliativmedizinische Behandlung vor allem darauf, die Symptome und Beschwerden der Betroffenen bestmöglich zu lindern, damit sie möglichst in ihre vertraute Umgebung zurückkehren können. Neben den körperlichen Symptomen gehört dazu auch das soziale und psychische Wohlbefinden – den Menschen ganzheitlich zu betrachten ist unser Verständnis von guter Betreuung und Pflege.
Das Pankreaskarzinom = Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine sehr aggressive Krebserkrankung. Bei vielen Betroffenen lassen sich bereits bei der ersten Diagnosestellung Metastasen = Tochtergeschwüre in anderen Organen nachweisen. In diesem Stadium der Erkrankung ist eine Heilung häufig nicht mehr möglich. Die entscheidenden Behandlungsziele sind hier die Beobachtung des Krankheitsverlaufs und die Lebensverlängerung unter Verbesserung der Lebensqualität. Eine Möglichkeit zur Linderung der Symptome bieten – neben einer wirksamen Schmerztherapie – unter bestimmten Voraussetzungen die Strahlentherapie, Chemotherapie. Immuntherapie und eine molekular zielgerichtete Therapie = Antikörpertherapie.
Unsere Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam in unserem zertifizierten Pankreaszentrum sowohl gut- als auch bösartige Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse umfassend und qualitätsgesichert.
Siehe auch: Erkrankungen der Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Bauchspeicheldrüse, Nebenniere & Milz
Der Prostatakrebs = Prostatakarzinom ist die häufigste Krebserkrankung des Mannes. Prostatakrebs macht im Frühstadium keine Beschwerden und wird häufig durch Vorsorgeuntersuchungen – z.B. PSA-Wert-Bestimmung mit anschließender Biopsie – entdeckt. Im Frühstadium ist das Prostatakarzinom gut behandelbar und meist heilbar. Der Prostatakrebs wird in Risikostadien unterteilt. Vom jeweiligen Stadium hängt die entsprechende Therapie ab.
Als Behandlungsverfahren kommen – neben einer Operation – auch eine Strahlentherapie oder die Brachytherapie = Bestrahlung mittels radioaktiver Teilchen in Betracht. In einigen Fällen ist die aktive Überwachung des Krebses ausreichend. Die Operation erfolgt meist minimalinvasiv roboterassistiert mittels Da-Vinci Xi OP-Roboter. Dadurch verringern sich die Komplikationen, der Patient erholt sich schneller und die Nebenwirkungen – z.B. hoher Blutverlust, Wundheilungsstörungen und Inkontinenz. Der Krankenhausaufenthalt beträgt meist nur wenige Tage.
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Klinik für Urologie im St. Bernward Krankenhaus ist die Behandlung von Patienten mit Prostatakrebs. Hierfür steht uns vor Ort ein hauseigener Da-Vinci Xi OP-Roboter zur Verfügung. Alle Patienten werden in Tumorkonferenzen vorgestellt und durch unser Uroonkologisches Zentrum mitbetreut. Eine der Kernkompetenzen unserer Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II ist zudem die medikamentöse Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs. Darüber hinaus werden sie gegebenenfalls im Rahmen unseres zertifizierten Onkologischen Zentrums betreut.
Zu den Gynäkologischen Tumoren gehören unterschiedliche Tumorformen, die verschiedene Organe betreffen können: die Gebärmutter, den Gebärmutterhals, die Eierstöcke, die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane. Die meisten Tumore treten im höheren Lebensalter auf.
Das Vaginalkarzinom = Scheidenkrebs gehört zu den eher selteneren Krebserkrankungen. Meist wird er durch die Ausbreitung von Tumoren aus benachbarten Organen in die Scheide verursacht. – z.B. aus der Harnröhre oder aus dem Gebärmutterhals. Vorwiegend Frauen zwischen 60 und 65 Jahren sind von Scheidenkrebs betroffen. Zu den Risikofaktoren für die Entstehung von Scheidenkrebs gehören unter anderem Virusinfektionen oder erhöhte Strahlenbelastung im Beckenbereich. Die Diagnose Scheidenkrebs ist häufig ein Zufallsbefund einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung. Symptome treten meist erst im fortgeschrittenen Stadium auf – dazu gehören beispielsweise Unterleibsschmerzen, zäher, blutiger Ausfluss, Scheidenblutungen und Organstörungen von Harnblase oder Darm. Scheidenkrebs lässt sich meist erfolgreich mit einer Kombination aus Bestrahlung und Operation behandeln.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Die Schilddrüse befindet sich unterhalb des Kehlkopfes vor der Luftröhre. Sie gehört zu den hormonproduzierenden Organen und spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation vieler Körperfunktionen. Zu den hormonproduzierenden Organen gehören die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse, die Nebennieren und die Bauchspeicheldrüse = Pankreas. Erkrankungen der Schilddrüse können sich durch eine diffuse Vergrößerung, eine knotige Umstrukturierung oder durch eine Funktionsstörung des Organs zeigen. Dementsprechend vielseitig sind die Beschwerden.
Die Nebenschilddrüsen sind vier ungefähr erbsengroße Drüsen, die an der Rückseite der Schilddrüse liegen und das sogenannte Parathormon produzieren. Dieses Hormon reguliert den Calciumstoffwechsel.
Erkranken die Schilddrüse oder die Nebenschilddrüse ist eine Operation oft die Therapie der Wahl. Sie gibt den Patienten Sicherheit und kann eine dauerhafte körperliche Beeinträchtigung vermeiden. Selbstverständlich besprechen wir diesen Schritt mit unseren Patienten nach einer ausführlichen und differenzierten Diagnostik. Die Endokrine Chirurgie ist die Chirurgie der hormonproduzierenden Organe. Die Überwachung des Stimmbandnervs während der Schilddrüsenoperation ist bei uns selbstverständlich.
Unsere Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam sowohl gut- als auch bösartige Erkrankungen umfassend und qualitätsgesichert.
Siehe auch: Pankreaskarzinom, endokrine Erkrankungen
Zu den Gynäkologischen Tumoren gehören unterschiedliche Tumorformen, die verschiedene Organe betreffen können: die Gebärmutter, den Gebärmutterhals, die Eierstöcke, die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane. Die meisten Tumoren treten im höheren Lebensalter auf.
Der Vulvakrebs = Vulvakarzinom ist eine Krebserkrankung der äußeren Geschlechtsorgane. Er betrifft die Schamregion im Hautbereich – meist die Schamlippen – älterer Frauen. Bei jüngeren Frauen ist der Vulvakrebs häufig auf eine Infektion mit Humanen Papilloma Viren (HPV) zurückzuführen. Anzeichen für eine Erkrankung können z.B. Schmerzen, Wundsein, Jucken und / oder Brennen in den beschriebenen Hautregionen sein. Die Diagnose Vulvakarzinom ist häufig ein Zufallsbefund einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung. Bei Tumoren, die nicht durch eine Operation entfernt werden können oder bereits Lymphknoten befallen haben, kommt eine Strahlentherapie zum Einsatz, ggf. mit einer Chemotherapie kombiniert.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.

Chefarzt | Prof. Dr. med. Christian Könecke
Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie
– Medizinische Klinik II

Sekretariat | Susanne König-Banda
Tel.: 05121 90-1274 | Fax: 05121 90-1282
E-Mail Kontakt
Weitere Infos auch in unserer Sprechzeitenübersicht.
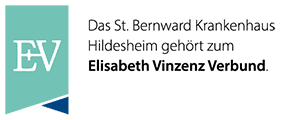
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Text das generische Maskulinum. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir alle Geschlechter ansprechen.