Unsere Schwerpunkte – Geburtshilfe & Gynäkologie
In unserer Abteilung für Geburtshilfe im St. Bernward Krankenhaus kommen jährlich etwa 1.600 Kinder zur Welt.
Gemeinsam mit der Klinik für Kinder- & Jugendmedizin und der Klinik für Kinderchirurgie führen wir ein Perinatalzentrum Level I. Unser Zentrum entspricht der höchstmöglichen Versorgungsstufe für Mutter und Kind. Dadurch können wir Mutter und Kind(er) vor, während und nach der Geburt auch in Hochrisikosituationen rundum auf höchstem Niveau betreuen.
Kernkompetenzen
Geburtshilfe
Wir kümmern uns bereits vor der Geburt um Sie und Ihren Nachwuchs. In unserer Pränatalambulanz unter der Leitung von Dr. Heike Effler bieten wir Ihnen folgende spezielle Untersuchungen an:
- Ersttrimesterdiagnostik, auch Nackenfaltenmessung genannt: erfolgt zwischen 11+0 bis 13+6 Schwangerschaftswoche, um mögliche Risiken für Fetus und Mutter abzuklären
- Fruchtwasserpunktion = Amniozentese: Fruchtwasseruntersuchungen führen wir ab der 15+0 Schwangerschaftswoche durch, um mögliche kindliche Erbkrankheiten abzuklären = Bestimmung des Chromosomensatzes
- Sonographische Feindiagnostik = Organultraschall:
Mit dieser Untersuchung können kindliche Fehlbildungen erkannt bzw. ausgeschlossen und Auffälligkeiten im Ultraschall untersucht werden – möglich zwischen der 20. und 22. Schwangerschaftswoche. - Dopplersonographie: Bei der Doppleruntersuchung wird der Blutfluss im Kreislauf des Kindes und der mütterlichen Gefäße gemessen. So kann die Versorgung des Ungeborenen überprüft und eine mögliche Mangelversorgung des Kindes oder der Kinder frühzeitig erkannt oder ausgeschlossen werden.
- Vorstellung zur Geburtsplanung
- Betreuung von sogenannten Risikoschwangerschaften, z.B. Mehrlingsgeburten, Infektionen in der Schwangerschaft, Schwangerschaftserkrankungen
Alle Informationen rund um die Geburt bei uns, die Ausstattung unserer Kreißsäle und sämtliche Begleitangebote finden Sie auf den Seiten unserer Geburtshilfe.
Unsere Babylotsen beraten und begleiten frischgebackene Mütter und Familien, die durch Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Not, Trennung, Krankheit, sprachliche Barrieren oder ähnliches besonders belastet sind. Ziel es ist, den Neugeborenen den besten Start ins Leben zu ermöglichen. Das Angebot ist selbstverständlich freiwillig und kostenlos.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite für Unterstützende Angebote. Vereinbaren Sie gern einen Termin mit uns. Über die Kontaktdaten & Sprechzeiten unserer Babylotsinnen informiert Sie unsere Übersichtsseite.
Das Team der sozialmedizinischen Nachsorge unterstützt frühgeborene, chronisch und schwerkranke Kinder und ihre Familien unmittelbar im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung in medizinischer, pflegerischer und psychosozialer Hinsicht. Ziel ist es, den Krankenhausaufenthalt zu verkürzen, neue Aufenthalte zu vermeiden und den Eltern Sicherheit im Umgang mit der Versorgung Ihres Kindes im häuslichen Umfeld zu geben – Hilfe zur Selbsthilfe. Das Angebot ist selbstverständlich freiwillig und kostenlos.
Weitere Informationen zum Angebot finden Sie hier.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite für Unterstützende Angebote. Vereinbaren Sie gern einen Termin mit uns. Über die Kontaktdaten & Sprechzeiten informiert Sie unsere Übersichtsseite.
Der Kurs wird von einer Psychologin und einer Hebamme geleitet und richtet sich an Mütter, die ihr Kind durch eine Fehlgeburt, Totgeburt, einen Schwangerschaftsabbruch oder auch in den ersten Lebenstagen verloren haben.
In einem geschützten Rahmen gibt es genügend Zeit und Raum, um einerseits über das Erlebte zu sprechen und Emotionen zuzulassen sowie andererseits die körperlichen Prozesse der Rückbildung anzuregen und zu begleiten. Weitere Informationen zum Angebot finden Sie auf der Seite unserer Elternschule unter Kurse für Sterneneltern.
Gynäkologie
Der Brustkrebs = Mammakarzinom ist eine bösartige Krebserkrankung des Brustgewebes und die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Häufig sind Frauen nach der Menopause = Wechseljahre betroffen. Wird der Brustkrebs frühzeitig entdeckt, kann er häufig geheilt werden. Daher sollten Frauen jeden Alters die Brustkrebs-Symptome kennen, auf sie achten und alle Möglichkeiten der Früherkennung nutzen. Bei Frauen ab 50 Jahren übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Früherkennungsuntersuchungen. Auch Männer können – wenn auch deutlich seltener – an Brustkrebs erkranken.
Dennoch bedeutet nicht jede Veränderung im Brustgewebe eine Krebserkrankung. Verhärtungen, Schwellungen oder Knoten können auch harmlose Ursachen haben. Moderne Untersuchungsverfahren ermöglichen das frühzeitige Erkennen der Vorstufen – auch wenn sich aus diesen keinesfalls zwangsläufig Brustkrebs entwickeln muss. Ob und wie eine mögliche Behandlung erfolgt, hängt von der Art der Veränderung und dem persönlichen Brustkrebsrisiko der Betroffenen ab. Symptome wie z.B. Verhärtungen oder Knoten in den Brüsten oder den Achselhöhlen, Hautveränderungen – z.B. Rötungen, Entzündungen oder Orangenhaut –, schmerzhafter oder nicht schmerzhafter Juckreiz der Brust, Veränderungen der Farbe oder Form der Brustwarzen oder Absonderung von Flüssigkeiten sollten jedoch schnellstmöglich fachärztlich abgeklärt werden.
Brustkrebs wird nach Entstehungsort und Stadium der Erkrankung unterteilt. Am häufigsten ist das sogenannte duktale Mammakarzinom – es entsteht in den Milchgängen. Hat der Brustkrebs seinen Entstehungsort in den Milchdrüsen, handelt es sich um das – deutlich seltenere – lobuläre Mammakarzinom. Die vier Einteilungsstadien des Brustkrebses zeigen auf, wie weit fortgeschritten die Erkrankung ist. Die Einteilung erfolgt nach der Größe des Tumors = Abkürzung T, der Beteiligung von Lymphknoten = Abkürzung N und dem Vorhandensein von Fernmetastasen = Abkürzung M.
Es gibt zahlreiche unterschiedliche Formen von Brustkrebs. Die konkreten Merkmale werden mittels spezieller Untersuchungen diagnostiziert – sie sind entscheidend für die jeweilige Therapie. So wachsen z.B. manche Brustkrebsarten unter dem Einfluss des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen. Entsprechende Medikamente blockieren die Wirkung des Hormons und erlauben so eine sehr erfolgreiche Behandlung dieser Brustkrebsformen. Andere Brustkrebse weisen spezifische Angriffspunkte, z.B. auf molekularer Ebene, auf. Diese erlauben eine zielgerichtete Therapie oder Immuntherapie.
Brustkrebs entsteht durch die Veränderungen des Erbguts gewöhnlicher Körperzellen: Die Körperzellen entarten und verlieren dadurch ihre spezifische Struktur und Funktion. In der Folge vermehren sie sich unkontrolliert und führen zum Wachstum von Krebs. Zu den Risikofaktoren zählen u.a. erbliche Veranlagung, Übergewicht = Adipositas, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Diabetes mellitus Typ II = Zuckerkrankheit, schädlicher Genussmittelkonsum, eine Hormonersatztherapie nach dem 50. Lebensjahr und dichtes Brustgewebe, dh. wenig Fett- dafür mehr Drüsen- und Bindegewebe. Häufig treten Brustkrebserkrankungen bei Frauen in der Altersspanne zwischen 50 und 70 Jahren auf. Zudem gilt das Risiko an einem Mammakarzinom zu erkranken bei Kinderlosigkeit, Erstgeburten nach dem 32. Lebensjahr, frühzeitigem Einsetzen der ersten Regelblutung und der späte Beginn der Wechseljahre als geringfügig erhöht.
Das Therapiekonzept des Mammakarzinoms hängt von dessen Stadium zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, der Lage des Tumors und den Eigenschaften der Krebszellen ab. Dank der Früherkennungsuntersuchungen wird Brustkrebs häufig in einem Stadium mit guten Heilungsaussichten entdeckt. Für die Wahl der Therapieverfahren spielen aber auch Vorerkrankungen, das Alter und der allgemeine Gesundheitszustand eine Rolle.
In Frage kommen – neben einer Operation – Strahlentherapie, Chemotherapie, Hormonblockade- oder Immuntherapien
Wenn irgend möglich, ist die brusterhaltende Operation die Therapie der ersten Wahl. Sie wird häufig mit anderen Therapieverfahren – z.B. der Strahlentherapie, der Chemotherapie oder anderen zielgerichteten Therapien kombiniert. Unter Umständen ist es auch – für eine schonendere Operationsmöglichkeit – erforderlich, große Mammatumore mithilfe anderer Therapien vor der Operation zu verkleinern. Im Rahmen der Operation werden Lymphknoten im Achselbereich entfernt und auf den Befall mit Krebszellen untersucht.
Ist eine Operation nicht möglich, kann eine Strahlentherapie zur Zerstörung des Mammakarzinoms eingesetzt werden – in frühen Stadien kann diese auch eine Heilung erreichen. Nach einer brusterhaltenden Operation wird die Strahlentherapie eingesetzt, um Rückfälle durch unerkanntes restliches Krebsgewebe zu verhindern. In fortgeschrittenen Stadien kann die Strahlentherapie große Tumoren verkleinern und so eine Operation erst ermöglichen.
Die Chemotherapie bekämpft Krebszellen, die durch die Operation oder eine Bestrahlung nicht entfernt werden konnten. Die Chemotherapie wird als systemische Therapie eingesetzt, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Brustkrebs unerkannt gestreut hat oder bereits Metastasen = Tochtergeschwulste festgestellt wurden.
Ein erheblicher Anteil der Mammakarzinome wächst unter dem Einfluss des Geschlechtshormons Östrogen. Durch die Gabe hormonblockierender Medikamente kann die Wirkung des Östrogens auf den Brustkrebs blockiert und der Brustkrebs bekämpft werden. Diese sogenannte Hormonblockadertherapie kann auch in Kombination mit anderen Therapien zum Einsatz kommen.
Einige Brusttumore lassen durch die Gabe spezieller Medikamente zerstören bzw. am Wachstum hindern. Diese sogenannten zielgerichteten Therapien sind jedoch nur dann wirksam, wenn der Brustkrebs entsprechende Angriffspunkte aufweist, dh. auf sie reagiert. Ob eine solche Therapie in Betracht kommt, wird durch die Untersuchung von Gewebeproben festgestellt.
Das körpereigene Immunsystem erkennt und zerstört Krebszellen in der Regel, bevor sich ein Brustkrebs entwickelt. Einige Krebszellen täuschen oder blockieren jedoch das Immunsystem – sie werden nicht als Krebszellen erkannt und somit nicht zerstört. Spezielle Immuntherapien schalten die Abwehrmechanismen der Krebszellen aus, so dass das körpereigene Immunsystem das Mammakarzinom bekämpfen kann.
Im Anschluss an die medizinische Behandlung gehören regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen unbedingt zur Therapie des Mammakarzinoms. Eine medizinische Rehabilitation – kurz: Reha – hilft den Betroffenen meist dabei, wieder in den Alltag zu finden. Bei der Beantragung unterstützt unser Sozial- und Entlassmanagement gern.
All diese Therapien haben Nebenwirkungen und Risiken. Deshalb ist eine sorgfältige Anamnese und eingehende Diagnostik elementar wichtig, um die bestmögliche Auswahl und Kombination der Verfahren zu gewährleisten.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Die wichtigsten Indikationen für die Spiegelung des Dickdarms = Koloskopie ist die Suche nach Polypen, um die Entstehung von Darmkrebs zu vermeiden – oder bei Verdacht auf bereits vorliegenden Darmkrebs. Die Ileo-Koloskopie nutzen wir, um die Ursachen von Durchfallerkrankungen und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu erkennen. Durch die Darmspiegelung können Krankheitsverläufe beurteilt und die richtigen Therapien gefunden werden. Auch für die Krebsvorsorge bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen ist die Darmspiegelung eine wichtige Untersuchungsmethode. Aufdehnungen = Dilatationen von Engstellen im Dickdarm und im Übergang von Dickdarm zu Dünndarm werden hier regelmäßig vorgenommen.
Die Darmspiegelung erfolgt in aller Regel nach einer kurz wirksamen Schlafspritze unter leitliniengerechter Überwachung.
Unsere Klinik für Innere Medizin & Gastroenterologie, die Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie behandeln gemeinsam in unserem zertifizierten Darmkrebszentrum Patienten mit Darm- und Darmkrebserkrankungen. Die Versorgung umfasst die Diagnostik, die Operation und die medikamentöse Therapie.
Siehe auch: Erkrankungen an Dick-, Mast- & Enddarm, Darmkrebs
Zu den Gynäkologische Tumoren gehören unterschiedliche Tumorformen, die verschiedene Organe betreffen können: die Gebärmutter, der Gebärmutterhals, die Eierstöcke, die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane. Die meisten Tumore treten im höheren Lebensalter auf – einige, wie z.B. der Gebärmutterhalskrebs – bereits in jüngeren Jahren.
Der Eierstockkrebs = Ovarialkarzinom ist ein sehr aggressiver und häufig vorkommender Tumor. Er tritt häufig bei Frauen jenseits der 50 Jahre auf – kann aber auch jüngere Frauen betreffen. Es gibt mehrere Formen von Eierstockkrebs – abhängig davon, welcher Zelltyp den Krebs hervorruft. Risikofaktoren für eine Erkrankung sind z.B. erbliche Veranlagung, Adipositas = Fettleibigkeit und späte Geburten. Häufige Schwangerschaften und die Verhütung mit der Pille scheinen das Risiko zu senken. Eierstockkrebs wird meist erst in einem späten Krankheitsstadium diagnostiziert. Unbestimmte Bauch- oder Beckenschmerzen, Druckgefühl, ein aufgeblähter Bauch durch Flüssigkeitsansammlung oder unklare Verdauungsbeschwerden können frühe Anzeichen für eine Erkrankung sein. Da der Eierstockkrebs häufig im Frühstadium unerkannt bleibt, stehen die Heilungschancen eher ungünstig. Nach Möglichkeit wird der Tumor nach seiner Entdeckung operativ entfernt. Der Operation folgt in der Regel eine Chemotherapie.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Eierstockzysten = Ovarialzysten sind meist harmlos. Erst ab einer bestimmten Größe verursachen sie Symptome, z.B. Bauchschmerzen. Die meisten Ovarialzysten sind funktionelle Zysten. Betroffen sind fast ausschließlich geschlechtsreife Frauen – mit Häufigkeitsgipfeln kurz nach der Pubertät und in den Wechseljahren. Zysten werden oft zufällig bei der Untersuchung getastet, im Ultraschall entdeckt oder machen sich durch Beschwerden bemerkbar. Je nach Art der Zyste reicht zunächst eine Beobachtung aus. Funktionstüchtige Zysten können unter Umständen auch durch die Verbesserung des Hormonhaushalts therapiert werden. Ab einer gewissen Größe oder bei unregelmäßiger Beschaffenheit sollten jedoch auch beschwerdefreie Zysten operativ entfernt werden. Eine solche Operation wird in der Regel minimalinvasiv im Rahmen einer Bauchspiegelung durchgeführt. Die Eierstockzyste wird entfernt und eine Verdrehung des Eierstocks gegebenenfalls aufgelöst.
Im Kindes- oder Jugendalter kommen verschiedene Formen von Eierstockzysten vor: Funktionelle Zysten oder Retentionszysten treten meist bei noch unregelmäßigem Hormonhaushalt in der Pubertät auf – gelegentlich auch im normalen Menstruationszyklus. Dermoidzysten = matures Teratom sind in der Regel gutartig – können jedoch sehr groß werden. Bei Zysten-Neubildungen handelt sich um seltene Keimzelltumore, die eine spezielle Diagnostik und Therapie erfordern.
Grundsätzlich erfolgt die Therapie der Eierstockzyste je nach Zystentyp und auftretenden Beschwerden. Eine Verdrehung des Eierstocks sollte allerdings so schnell wie möglich operativ behoben werden, damit es durch eine Abschnürung der Gefäßversorgung nicht zum Absterben des Eierstocks kommt. In manchen Fällen kann der Eierstock auch zurückgedreht werden.
Das Leistungsspektrum unserer Klinik für Kinderchirurgie, der Klinik für Allgemein-, Viszeral- & Onkologische Chirurgie & Spezielle Viszeralchirurgie und der Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe umfasst den gesamten Bereich traditioneller und neuer Operationsverfahren mit und ohne Kunstmaterial. Die besonders schonende laparoskopische Operation = Schlüssellochoperation setzen wir regelmäßig ein. Im Bereich der Allgemein-, Viszeral- und Onkologischen Chirurgie auch den Da-Vinci-OP-Roboter.
Zu den Gynäkologische Tumoren gehören verschiedene Tumorformen, die unterschiedliche Organe betreffen können: dazu gehören die Gebärmutter, der Gebärmutterhals, die Eierstöcke, die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane. Die meisten Tumoren treten im höheren Lebensalter auf – einige, wie z.B. der Gebärmutterhalskrebs – bereits in jüngeren Jahren.
Durch Geschlechtsverkehr können sogenannte Humane Papillomviren – kurz HPV – übertragen werden, die Gebärmutterhalskrebs = Zervixkarzinom auslösen können. Der Gebärmutterhals ist die Verbindung zwischen Scheide und Gebärmutter. Neben einer HPV-Infektion stellen u.a. ein früher Beginn sexueller Aktivität, eine hohe Anzahl wechselnder Sexualpartner, viele Schwangerschaften – vor allem in jungen Jahren – und eine langjährige Einnahme der Pille Risikofaktoren dar, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Durch eine Impfung gegen bestimmte krebserregende Typen der HP-Viren sinkt das Erkrankungsrisiko deutlich. Auch der Zellabstrich vom Gebärmutterhals bei der jährlichen, kostenlosen Untersuchung zur Krebsfrüherkennung gibt Aufschluss über mögliche Zellveränderungen. Diese Veränderungen können behandelt werden, bevor der Krebs entsteht. Unterleibs- oder Beckenschmerzen, ungewöhnliche Blutungen, übelriechender Ausfluss oder Schmerzen bei Wasserlassen oder Stuhlgang können auf Gebärmutterhalskrebs hinweisen. Behandelt wird der Gebärmutterhalskrebs in der Regel durch Bestrahlung von außen und Brachytherapie oder medikamentöse Therapie – z.B. Chemotherapie.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Der Gebärmutterkrebs = Uteruskarzinom oder Korpuskarzinom ist ein bösartiger Tumor der meist im oberen Teil des Uterus, dem Gebärmutterkörper = Korpus entsteht. Er entwickelt sich allerdings in der Regel nicht aus der Muskelschicht, sondern aus der Schleimhaut der Gebärmutter und verursacht den Gebärmutterschleimhautkrebs = Endometriumkarzinom.
Siehe auch: Gynäkologische Tumore – Gebärmutter, Gebärmutterhals, Eierstöcke, Scheide & äußere Geschlechtsorgane, Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutterschleimhautkrebs
Zu den Gynäkologische Tumoren gehören unterschiedliche Tumorformen, die verschiedene Organe betreffen können: die Gebärmutter, den Gebärmutterhals, die Eierstöcke, die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane.
Beim Gebärmutterschleimhautkrebs = Endometriumkarzinom bilden sich Tumoren in der Schleimhaut der Gebärmutter. Unterschieden werden zwei Typen von Tumoren: das häufigere östrogenabhängige Typ 1 Karzinom und das östrogenunabhängige Typ 2 Karzinom. Beim Typ 1 Karzinom sind die Tumorzellen den gesunden Zellen noch recht ähnlich und daher wenig aggressiv. Beim Typ 2 Karzinom sind die Tumorzellen entartet und somit aggressiver. Typ 2 tritt häufiger bei älteren Patientinnen auf. Ursächlich für den Gebärmutterschleimhautkrebs sind z.B. Bluthochdruck, Fettleibigkeit = Adipositas, eine frühe Menstruation und eine späte Menopause. Da beim Gebärmutterschleimhautkrebs kaum Symptome auftreten, wird er häufig erst in einem späteren Krankheitsstadium erkannt. Mögliche, gegebenenfalls durch den Gynäkologen = Frauenarzt abzuklärende Symptome sind z.B. Ausflüsse oder Blutungen vor der Menopause, die nicht mit der Periode zusammenhängen, ebenso jegliche Blutungen nach der Menopause. Die Behandlung von Gebärmutterschleimhautkrebs hängt vom Krankheitsstadium ab. Häufig ist eine Operation die Therapie der ersten Wahl, der meist eine Bestrahlung folgt. Ist eine Operation nicht zielführend oder möglich, erfolgt eine alleinige Bestrahlung – ggf. kombiniert mit einer Chemotherapie.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Zu den Gynäkologische Tumoren gehören unterschiedliche Tumorformen, die verschieden Organe betreffen können: die Gebärmutter, den Gebärmutterhals, die Eierstöcke, die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane. Die meisten Tumoren treten im höheren Lebensalter auf – einige, wie z.B. der Gebärmutterhalskrebs – bereits in jüngeren Jahren.
Beim Gebärmutterschleimhautkrebs = Endometriumkarzinom bilden sich Tumoren in der Schleimhaut der Gebärmutter. Unterschieden werden zwei Typen von Tumoren: das häufigere östrogenabhängige Typ 1 Karzinom und das östrogenunabhängige Typ 2 Karzinom. Beim Typ 1 Karzinom sind die Tumorzellen den gesunden Zellen noch recht ähnlich und daher wenig aggressiv. Beim Typ 2 Karzinom sind die Tumorzellen entartet und somit aggressiver. Typ 2 tritt häufiger bei älteren Patientinnen auf. Ursächlich für den Gebärmutterschleimhautkrebs sind z.B. Bluthochdruck, Fettleibigkeit = Adipositas, eine frühe Menstruation und eine späte Menopause. Da beim Gebärmutterschleimhautkrebs kaum Symptome auftreten, wird er häufig erst in einem späteren Krankheitsstadium erkannt. Mögliche, gegebenenfalls durch den Gynäkologen = Frauenarzt abzuklärende Symptome sind z.B. Ausflüsse oder Blutungen vor der Menopause, die nicht mit der Periode zusammenhängen, ebenso jegliche Blutungen nach der Menopause. Die Behandlung von Gebärmutterschleimhautkrebs hängt vom Krankheitsstadium ab. Häufig ist eine Operation die Therapie der ersten Wahl, der meist eine Bestrahlung folgt. Ist eine Operation nicht zielführend oder möglich, wird eine alleinige Bestrahlung – ggf. kombiniert mit einer Chemotherapie – durchgeführt.
Durch Geschlechtsverkehr können sogenannte Humane Papillomviren – kurz HPV – übertragen werden, die Gebärmutterhalskrebs = Zervixkarzinom auslösen können. Der Gebärmutterhals ist die Verbindung zwischen Scheide und Gebärmutter. Neben einer HPV-Infektion stellen u.a. ein früher Beginn sexueller Aktivität, eine hohe Anzahl wechselnder Sexualpartner, viele Schwangerschaften – vor allem in jungen Jahren – und eine langjährige Einnahme der Pille Risikofaktoren dar, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Durch eine Impfung gegen bestimmte krebserregende Typen der HP-Viren sinkt das Erkrankungsrisiko deutlich. Auch der Zellabstrich vom Gebärmutterhals bei der jährlichen, kostenlosen Untersuchung zur Krebsfrüherkennung gibt Aufschluss über mögliche Zellveränderungen. Diese Veränderungen können behandelt werden, bevor der Krebs entsteht. Unterleibs- oder Beckenschmerzen, ungewöhnliche Blutungen, übelriechender Ausfluss oder Schmerzen bei Wasserlassen oder Stuhlgang können auf Gebärmutterhalskrebs hinweisen. Behandelt wird der Gebärmutterhalskrebs in der Regel durch Bestrahlung von außen und Brachytherapie oder medikamentöse Therapie – z.B. Chemotherapie.
Der Gebärmutterkrebs = Uteruskarzinom, Korpuskarzinom ist ein bösartiger Tumor der meist im oberen Teil des Uterus, dem Gebärmutterkörper = Korpus entsteht. Er entwickelt sich allerdings in der Regel nicht aus der Muskelschicht, sondern aus der Schleimhaut der Gebärmutter und verursacht den Gebärmutterschleimhautkrebs = Endometriumkarzinom (s.o.).
Der Eierstockkrebs = Ovarialkarzinom ist ein sehr aggressiver und häufig vorkommender Tumor. Er tritt häufig bei Frauen jenseits der 50 Jahre auf – kann aber auch jüngere Frauen betreffen. Es gibt mehrere Formen von Eierstockkrebs – abhängig davon, welcher Zelltyp den Krebs hervorruft. Risikofaktoren für eine Erkrankung sind z.B. erbliche Veranlagung, Adipositas = Fettleibigkeit und späte Geburten. Häufige Schwangerschaften und die Verhütung mit der Pille scheinen das Risiko zu senken. Eierstockkrebs wird meist erst in einem späten Krankheitsstadium diagnostiziert. Unbestimmte Bauch- oder Beckenschmerzen, Druckgefühl, ein aufgeblähter Bauch durch Flüssigkeitsansammlung oder unklare Verdauungsbeschwerden können frühe Anzeichen für eine Erkrankung sein. Da der Eierstockkrebs häufig im Frühstadium unerkannt bleibt, stehen die Heilungschancen eher ungünstig. Nach Möglichkeit wird der Tumor nach seiner Entdeckung operativ entfernt. Der Operation folgt in der Regel eine Chemotherapie.
Das Vaginalkarzinom = Scheidenkrebs gehört zu den eher selteneren Krebserkrankungen. Meist wird er durch die Ausbreitung von Tumoren aus benachbarten Organen in die Scheide verursacht. – z.B. aus der Harnröhre oder aus dem Gebärmutterhals – in die Scheide ausbreiten. Vorwiegend Frauen zwischen 60 und 65 Jahren sind von Scheidenkrebs betroffen. Zu den Risikofaktoren für die Entstehung von Scheidenkrebs gehören z.B. Virusinfektionen mit Viren oder erhöhte Strahlenbelastung im Beckenbereich. Die Diagnose Scheidenkrebs ist häufig ein Zufallsbefund einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung. Symptome treten meist erst im fortgeschrittenen Stadium auf – dazu gehören z.B.Unterleibsschmerzen, zäher, blutiger Ausfluss, Scheidenblutungen und Organstörungen von Harnblase oder Darm. Scheidenkrebs lässt sich meist erfolgreich mit einer Kombination aus Bestrahlung und Operation behandeln.
Der Vulvakrebs = Vulvakarzinom ist eine Krebserkrankung der äußeren Geschlechtsorgane. Er betrifft meist die Schamregion im Hautbereich – meist die Schamlippen – älterer Frauen. Bei jüngeren Frauen ist der Vulvakrebs häufig auf eine Infektion mit Humanen Papilloma Viren (HPV) zurückzuführen. Anzeichen für eine Erkrankung können z.B. Schmerzen, Wundsein, Jucken und / oder Brennen in den beschriebenen Hautregionen sein. Die Diagnose Vulvakarzinom ist häufig ein Zufallsbefund einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung. Bei Tumoren, die nicht durch eine Operation entfernt werden können oder bereits Lymphknoten befallen haben, kommt eine Strahlentherapie zum Einsatz und ggf. mit einer Chemotherapie kombiniert.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Bei der Inkontinenz können die Betroffenen aus unterschiedlichen Gründen ihren Harn oder Stuhl ganz oder teilweise nicht mehr halten. Die Ursachen sind vielfältig. Oft beruht die Harninkontinenz auf einer Störung im System aus Blasenmuskulatur, Schließmuskeln und Beckenbodenmuskulatur – zum Beispiel, wenn Fehler in der Signalübertragung der beteiligten Nervenzellen auftreten. Es gibt inzwischen gute Therapiemöglichkeiten für Inkontinenz.
Der unkontrollierte Urinverlust = Harninkontinenz wird in eine Drang- und eine Stress- oder Belastungsinkontinenz unterteilt. Während die Dranginkontinenz durch eine „überaktive“ Blase ausgelöst sein kann, ist die Belastungsinkontinenz durch Druckerhöhungen im Bauchraum und einen geschwächten Schließmuskel bedingt. Bei der Stress- oder Belastungsinkontinenz kommt es je nach Ausprägung beim Niesen, Aufstehen oder Gehen zu einem Urinverlust. Dies kann bei Frauen unter anderem nach Geburten und bei Männern nach Prostataoperationen der Fall sein.
Die Dranginkontinenz kann zum Beispiel durch die Injektion von Botox in die Harnblasenwand behandelt werden. Dies geschieht über eine Blasenspiegelung. Bei Männern müssen andere Ursachen wie eine Prostatavergrößerung ausgeschlossen werden. Die Stress- oder Belastungsinkontinenz kann je nach Ursache durch Einlage von Bändern, eine Beckenbodenrekonstruktion, Pessar-Einlage (Frau) oder den Einbau eines künstlichen Schließmuskels (Mann) erfolgen.
Inkontinenz ist für die meisten Menschen ein sehr intimes Thema. Deshalb verschweigen viele Betroffene ihre Beschwerden. Die Diagnosestellung ist jedoch wichtig, da dann effektive Behandlungsmaßnahmen möglich sind, die die Lebensqualität von Betroffenen deutlich verbessern können.
Unsere Klinik für Geriatrie & Neurogeriatrie behandelt in Zusammenarbeit mit der Klinik für Urologie und der Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe Patienten mit Inkontinenz. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik und Therapie.
Ein Myom ist ein häufiger gutartiger Tumor bei Frauen, der sich aus Muskelzellen entwickelt. Oft wird der Begriff synonym für das Gebärmuttermyom verwendet. Myome in der Gebärmutter sind meist nicht gefährlich und verursachen häufig auch keine Symptome – dann ist auch in der Regel keine Therapie erforderlich. Sollten sie Beschwerden und Komplikationen verursachen, erfolgt eine medikamentöse oder eine minimalinvasiv-operative Behandlung – je nach Größe und Lage des Myoms oder der Myome. Festgestellt werden Myome meist im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung. Die Ursachen für ihre Entstehung sind noch unklar – vermutlich spielen genetische Veranlagungen und hormonelle Einflüsse eine Rolle.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe behandelt Patientinnen mit Myomen. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Zu den Gynäkologischen Tumoren gehören unterschiedliche Tumorformen, die verschiedene Organe betreffen können: die Gebärmutter, den Gebärmutterhals, die Eierstöcke, die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane. Die meisten Tumore treten im höheren Lebensalter auf.
Das Vaginalkarzinom = Scheidenkrebs gehört zu den eher selteneren Krebserkrankungen. Meist wird er durch die Ausbreitung von Tumoren aus benachbarten Organen in die Scheide verursacht. – z.B. aus der Harnröhre oder aus dem Gebärmutterhals. Vorwiegend Frauen zwischen 60 und 65 Jahren sind von Scheidenkrebs betroffen. Zu den Risikofaktoren für die Entstehung von Scheidenkrebs gehören unter anderem Virusinfektionen oder erhöhte Strahlenbelastung im Beckenbereich. Die Diagnose Scheidenkrebs ist häufig ein Zufallsbefund einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung. Symptome treten meist erst im fortgeschrittenen Stadium auf – dazu gehören beispielsweise Unterleibsschmerzen, zäher, blutiger Ausfluss, Scheidenblutungen und Organstörungen von Harnblase oder Darm. Scheidenkrebs lässt sich meist erfolgreich mit einer Kombination aus Bestrahlung und Operation behandeln.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.
Senkungszustände des weiblichen Beckens treten bei Lockerung des Band- und Halteapparats auf und haben meist kombinierte Ursachen. Dabei kommt es fast immer zu Störungen der Harnblasen bzw. der Stuhlentleerung. Zunächst wird exakt die Art und das Ausmaß des Vorfalls bestimmt. Dies reicht von leichten Senkungen der Harnblase oder des Enddarms bis zum Totalprolaps mit Vorfall aller Beckenorgane nach außen. Entscheidend ist anschließend die anatomisch richtige Lagekorrektur – dabei können wir auf das gesamte Spektrum der Beckenbodenchirurgie zurückgreifen.
Eingesetzt werden vaginale Plastiken oder in Rezidivsituationen Spezialnetze, ferner laparoskopische oder offene Formen der Sakropexie. Eine sogenannte Sakropexie kommt bei einer Senkung im mittleren Bereich des Beckenbodens in Betracht – z.B. wenn die Gebärmutter tiefer liegt. Bei diesem Operationsverfahren werden das Scheidenende oder der Gebärmutterhals mithilfe eines Kunststoffnetzes am Kreuz- oder Steißbein befestigt. Nur in seltenen Fällen muss auch die Gebärmutter mit entfernt werden.
Im Rahmen unserer Inkontinenz-Sprechstunde bieten wir die Möglichkeit einer individuellen Diagnostik und Beratung.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe und die Klinik für Urologie im St. Bernward Krankenhaus behandeln in enger Zusammenarbeit Patientinnen mit Senkungszuständen des Beckens. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie. Im Bereich der Urologie steht uns vor Ort ein hauseigener Da-Vinci-OP-Roboter zur Verfügung.
Zu den Gynäkologischen Tumoren gehören unterschiedliche Tumorformen, die verschiedene Organe betreffen können: die Gebärmutter, den Gebärmutterhals, die Eierstöcke, die Scheide und die äußeren Geschlechtsorgane. Die meisten Tumoren treten im höheren Lebensalter auf.
Der Vulvakrebs = Vulvakarzinom ist eine Krebserkrankung der äußeren Geschlechtsorgane. Er betrifft die Schamregion im Hautbereich – meist die Schamlippen – älterer Frauen. Bei jüngeren Frauen ist der Vulvakrebs häufig auf eine Infektion mit Humanen Papilloma Viren (HPV) zurückzuführen. Anzeichen für eine Erkrankung können z.B. Schmerzen, Wundsein, Jucken und / oder Brennen in den beschriebenen Hautregionen sein. Die Diagnose Vulvakarzinom ist häufig ein Zufallsbefund einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung. Bei Tumoren, die nicht durch eine Operation entfernt werden können oder bereits Lymphknoten befallen haben, kommt eine Strahlentherapie zum Einsatz, ggf. mit einer Chemotherapie kombiniert.
Unsere Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe, die Klinik für Hämatologie, Onkologie & Immunologie – Medizinische Klinik II und die Schwerpunktpraxis von Dr. Christoph Uleer für gynäkologische Onkologie in der Bahnhofstraße behandeln Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren ambulant und stationär. Die Versorgung umfasst die gesamte Diagnostik, Operation und Therapie.

Chefärztin | Dr. med. Susanne Peschel
Klinik für Gynäkologie & Geburtshilfe
Weitere Informationen

Sekretariat | Jana Mädel
Tel.: 05121 90-1801 | Fax: 05121 90-1804
E-Mail Kontakt
Weitere Infos auch in unserer Sprechzeitenübersicht.
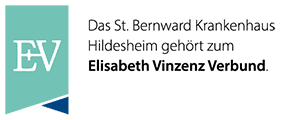
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Text das generische Maskulinum. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir alle Geschlechter ansprechen.
Zusätzliche Informationen zu Dr. med. Susanne Peschel

- Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Schwerpunkt spezielle Geburtshilfe und Perinatologie
- Schwerpunkt gynäkologische Onkologie
- Seniorbrustoperateurin (nach Onkozert)
- AWO-Gyn. Brustoperateurin, plastisch-rekonstruktive und ästhetische Brustoperationen,
- Fachgebundene Psychotherapie, Psychoonkologie (anerkannt durch DKG), Suchtmedizin
- Ärztliches Qualitätsmanagement
- Auditorin für Brust-, Gynäkologische- und Onkologische Krebszentren (Onkozert)
- Diplom-Gesundheitsökonomin













